 |
|
Buchveröffentlichungen
|
Gustl Marlock (Hg.),
Halko Weiss (Hg.), Lutz Grell-Kamutzki (Hg.),
Dagmar Rellensmann (Hg.)
Handbuch K�rperpsychotherapie (2.
Aufl.) 2023.
"Manfred Thielen hat
in der �berarbeiteten Neuauflage des "Handbuch
f�r K�rperpsychotherapie" zwei Artikel ver�ffentlicht:
" K�rperpsychotherapie bei Depression"
(S. 796-813) "K�rperpsychotherapie bei
Angst" (S. 814-835).
|
|
 |
M.Thielen (2022):
K�rperpsychotherapie und Entfremdung.
In: K�rper Tanz Bewegung, 4/2022,
S. 130-145. |
|
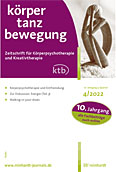 |
|
Manfred Thielen, Werner
Eberwein (Hg.):
Fühlen und Erleben in der Humanistischen
Psychotherapie.
Psychosozial-Verlag.
Taschenbuch: 200 Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3837929213
ISBN-13: 978-3837929218
Größe und/oder Gewicht: 14,8
x 2,2 x 20,8 cm
Preis Euro (D): 29,90
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|
 |
|
Ulfried Geuter
Praxis Körperpsychotherapie.
10 Prinzipien der Arbeit im therapeutischen
Prozess.
Berlin 2019, Springer.
Taschenbuch, 508 Seiten, Broschur,
17 x 2,7 x 24,4 cm
Auflage: 1. Aufl. 2019
ISBN-10: 3662565951
ISBN-13: 978-3662565957
Preis Euro (D): 44,99
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|
 |
|
Manfred Thielen, Angela
von Arnim, Anna Willach-Holzapfel (Hg.):
Lebenszyklen-Körperrhythmen.
Körperpsychotherapie über die
Lebensspanne.
Gießen 2018, Psychosozial-Verlag.
Taschenbuch: 385 Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3837927822
ISBN-13: 978-3837927825
Größe: 14,9 x 3 x 21,1 cm
Preis Euro (D): 39,90
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|
 |
|
Thomas Harms & Manfred
Thielen (Hg.)
Körperpsychotherapie und Sexualität
Grundlagen, Perspektiven und Praxis
Verlag: Psychosozial-Verlag
Buchreihe: Therapie & Beratung
325 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm
Erschienen im Juni 2017
ISBN-13: 978-3-8379-2680-4
Preis Euro (D): 34,90
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|
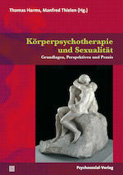 |
|
Ulfried Geuter
Körperpsychotherapie.
Grundriss einer
Theorie für die Klinische Praxis
Verlag: Springer
380 Seiten
Erschienen im März 2015
ISBN-10: 3642040136
ISBN-13: 978-3642040139
Preis Euro (D): 49,99
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|
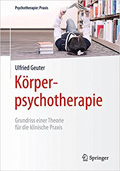 |
|
Werner Eberwein, Manfred
Thielen (Hg.)
Humanistische Psychotherapie: Theorien,
Methoden, Wirksamkeit.
Gießen 2014,
Psychosozial-Verlag.
Taschenbuch: 337 Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 9783837923513
ISBN-13: 978-3837923513
ASIN: 3837923517
Gößee und/oder Gewicht: 14,6
x 3 x 21,1 cm
Preis Euro (D): 39,90
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|

|
|
Manfred Thielen (Hg.)
Körper-Gruppe-Gesellschaft
Neue Entwicklungen
in der Körperpsychotherapie
ca. 440 Seiten
Broschur Preis Euro (D): 39,90
ISBN 978-3-8379-2236-3
Buchreihe: Therapie & Beratung
Erscheint im April 2013
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|

|
|
Manfred Thielen(Hg.):
Narzissmus: Körperpsychotherapie
zwischen Energie und Beziehung
Taschenbuch: 236
Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3934391133
ISBN-13: 978-3934391130
Verpackungsabmessungen: 20,6 x 14,4 x 1,7 cm
>>
Informationen zum Buch
>>
Buch bestellen
|
|
 |
|
Körperpsychotherapie zwischen Lust-
und Realitätsbegriff.
Verein
für Integrative Biodynamik (Hrsg.:)
Oldenburg 1994, Transform Verlag (vergriffen).
|
|
|
Trauma, Krise, Chance,
Neubeginn:
Körperpsychotherapie bei narzisstischen Selbstwertkrisen
von Manfred Thielen
Narzisstische Menschen glauben,
sie seien die „Allergrößten“,
den Anderen überlegen, großartig und
unerreichbar u.a., dieses Bild wird in der populärwissenschaftlichen
Literatur gezeichnet (s. Psychologie heute, Juli
2004, S. 30 ff). In der klinischen psychotherapeutischen
Praxis sind diese „Narzissten“ in
ihrer Reinform allerdings selten anzutreffen,
da sie höchstwahrscheinlich keinen Leidensdruck
verspüren und deshalb keine Veranlassung
sehen, einen Psychotherapeuten/in aufzusuchen.
In der Praxis erleben wir eher narzisstische Menschen,
die in sich in Teilbereichen als grandios erleben,
aber vor allem durch starke Selbstwertschwankungen
geprägt sind. Sie schwanken in ihrer Selbsteinschätzung
zwischen Selbstüberschätzung und Selbstabwertung.
In der klinischen Fachliteratur, z.B. in „Diagnostisches
und Statistisches Manual psychischer Störungen
DSM-IV-R „ wird als Hauptmerkmal der narzisstischen
Persönlichkeitsstörung ein durchgängiges
Muster von Großartigkeit in Phantasie oder
Verhalten, von Überempfindlichkeit gegenüber
der Einschätzung durch andere und von Mangel
an Einfühlungsvermögen (Saß et
al., 2003, 781). Vielfältige Forschungsergebnisse
untermauern diese phänomenlogische Beschreibung
und benennen weitere spezifische Merkmale wie
Selbstwertschwankungen, Affekt-Labilität,
Suche nach Anerkennung und Bestätigung, Dominanzverhalten
u.a. (Sachse, 2002, 156 ff.).
Narzisstische Menschen schwanken in der Regel
zwischen Gefühlen von Grandiosität und
Minderwertigkeit, fühlen sich leer, dumpf,
depressiv und sind leicht kränkbar. Sowohl
in der Beziehung zu sich selbst als auch zu anderen
unterliegen sie dem Mechanismus der Idealisierung
und der Abwertung, als zwei Seiten ihres instabilen
Selbstwertgefühls. Sie leiden unter ihrer
Gefühlsabtrennung und sind zu tiefen, befriedigenden
Beziehungen nur schwer oder nicht in der Lage.
Der Psychoanalytiker und Selbstpsychologe Kohut
(1992,S. 41) hebt hervor, das sie im Größen-Selbst
leben und keinen bzw. wenig Kontakt zu ihrem Selbst
haben. Kernberg (1993,s. 261 ff.) betont ihre
emotionale Flachheit und Oberflächlichkeit,
ihren starken Neid und ihr großes Aggressionspotenzial.
Sie hätten die Tendenz zur Entwertung und
zur Zerstörung innerer Objektimagines und
äußerer Objekte.
Der Begründer der Bioenergetik Lowen (1986,
S. 18) hebt als Hauptmerkmal der narzisstischen
Störung die Gefühlsverleugnung heraus.
Ihr liegen tiefe schizoide Spaltungsprozesse zugrunde.
Auch Miller (1994, S. 66 ff.) betont in ihrem
„Das Drama des begabten Kindes“ die
„verlorene Welt der Gefühle“
als kennzeichnend für die narzisstische Problematik.
Im Mythos ist Narcissus ein Jüngling von
begehrenswerter Schönheit, der die Liebe
der Nymphe Echo verschmäht. Er sieht sein
Spiegelbild im Wasser und verliebt sich in sein
Abbild. Er ist so auf sein Abbild fixiert, dass
er die Quelle nicht verlassen kann und vor Schwäche
zugrunde geht. Sein Leib verwandelt sich in eine
Narzisse. In der Fassung des Mythos von Ovid gibt
es bereits einen für Psychotherapeuten sehr
wesentlichen Hinweis für die Heilung von
Narzissten. Der Seher Teiresias wird befragt,
ob Naricssus ein langes Leben haben werde. Er
antwortet::“ Ja, wenn er sich nie erkennen
wird.“ (Jacoby, 1985, S. 18). Im Mythos
erscheint der Tod als Bestrafung für Narcissus´
Unfähigkeit, seine Liebe dem Anderen, Echo,
zu geben. Die Prophezeiung des Teiresias kann
jedoch im Sinne von sich selbst erkennen verstanden
werden. Erst mit dem Sich- selbst -Erkennen ist
Wandlung, Transformation der krankhaften Persönlichkeit
und das Sterben der narzisstischen Anteile möglich.
(ebda., S. 20)
Narzisstische Menschen leben primär für
ihr Image, sie sind süchtig nach Anerkennung,
Beachtung und Bewunderung. Sie leiden an ihrer
Entleerung des Ichs und sind am äußeren
Schein orientiert.
Die narzisstische Imageorientierung wird gesellschaftlich
gefördert und auch produziert. In der postmodernen
Gesellschaft ist der Erfolg, der äußere
Schein, das Image wichtiger als innere Werte wie
Authentizität, Zufriedenheit, Stimmigkeit,
Macht-, Status- und Konsumsymbole haben einen
höheren Stellenwert als ein reiches psychisches
Leben und befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen.
Eine primär auf Profit orientierte Ökonomie
prägt auch die interaktiven Kommunikationsformen,
die pragmatische Kosten-Nutzen-Kalkulation steht
im Vordergrund. Der Andere wird zum Instrument
meiner Bedürfnisse und Interessen, insofern
fördert die postmoderne, spätkapitalistische
Gesellschaft die Herausbildung narzisstischer
Lebensstile. (s. auch Lasch, 1982)
Frühkindliche
Genese auf dem Hintergrund von Entwicklungspsychologie
und Säuglingsforschung
Die genaue Bestimmung einer frühkindlichen
Entwicklungsphase wird unter Narzissmusforschern
kontrovers diskutiert. Für den an der Gesprächspsychotherapie
orientierten Sachse (2002, 149) beginnt die narzisstische
Entwicklung erst im frühen Erwachsenenalter.
Doch die unterschiedlichen Richtungen der psychoanalytischen
Theorie wie Selbst-Psychologie (Kohut, Tolpin,
Wolf u.a.), Objektbeziehungstheorie (Kernberg,
Jacobson, Mahler, Materson, Winnicott u.a.) und
der Ich-Psychologie (A. Freud, Hartmann, Blanck&
Blanck u.a.) stimmen darin überein, den Beginn
der narzisstischen Entwicklung in der frühen
Kindheit zu sehen. Johnson(1988), der die narzisstische
Entwicklung umfassend aus integrativ humanistischer,
tiefenpsychologischer und körperpsychotherapeutischer
Sicht beschreibt, bezieht sich auf Mahlers Entwicklungsmodell
der kindlichen Entwicklung, die sie als Phasen
des normalen Autismus, der Symbiose und der Individuation
beschreibt (Mahler/ Pine/ Bergman, 1992). Er hebt
die Phase der Wiederannäherung an die Realität
(15.-24.Monat) hervor.
Die Wiederannäherung ist in der Mahlerschen
Entwicklungspsychologie eine Subphase des Loslösungs-
und Individuationsprozesses von der Mutter. In
dieser Phase geht es um die Getrenntheit des Kindes
von der Mutter und Gefühle wie Verletzlichkeit
und Begrenztheit. Idealisierung des anderen mit
der fortbestehenden Illusion des Einssein mit
diesem sind spontan auftretende Abwehrhaltungen
des Kleinkindes gegen Gefühle von Verletzlichkeit,
Ohnmacht und Abhängigkeit. In einer gelungenen
Entwicklung werden Grandiosität und Idealisierung
durch Anpassung an die Realität neutralisiert.
Wenn aber von den Eltern diese Wieder- annäherungsphase,
die mit adäquaten Frustrationen des Kindes
verbunden ist, selbst narzisstisch besetzt wird,
das Kind etwas Besonderes sein soll und idealisiert
wird, dann werden Grandiositäts- und Grenzenlosigkeitsgefühle
des Kleinkindes verstärkt. Und es kommt zu
narzisstischen Störungen. Die primären
Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, vermitteln
dem Kind Botschaften und Kernüberzeugungen
wie:“ Sei nicht, wer du bist, sei der, den
ich brauche. Der du bist, enttäuscht mir,
bedroht mich, ärgert mich, überreizt
mich. Sei, was ich will und ich werde dich lieben!“
(ebda. S. 54) Anstatt der notwendigen Empathie,
Fürsorge, Betreuung und Orientierung, erlebt
das Kleinkind Demütigungen und Abwertungen,
wenn es sich nicht so verhält, wie es sein
soll. Das so narzisstisch gekränkte Kind
passt sich aus Angst, das geliebte Objekt zu verlieren,
den elterlichen Anforderungen an und entwickelt
ein kompensiertes, von Außen bestimmtes,
„falsches“ Selbst..
Auf Grund der mangelnden Einfühlung und der
mangelnden Grenzen funktioniert die Wiederannäherung
des Kindes an die Realität nicht adäquat.
Es verbleibt in seinem Größen-Selbst,
erkennt seine Grenzen nicht ausreichend und zieht
seine libidinöse Energie von den Objekten
wieder ab und wendet sie dem eigenen Selbst zu.
Das Kind kann mit seinen echten Gefühlen
bei seinen Bezugspersonen nicht „landen“,
bekommt keine interaktive, spiegelnde Resonanz.
Diese frühe Enttäuschung ist häufig
bereits die Wurzel von Depressionen und der späteren
narzisstischen Selbstwertschwankungen.
Dem depressiven Verhalten liegen in der Regel
verdrängte bis abgespaltene Wutgefühle
zugrunde. Dieser Zusammenhang wird sowohl in der
selbstpsychologischen, psychoanalytischen Analyse
der Genese des Narzissmus als auch von Johnson
vernachlässigt, doch in der klinischen Erfahrung
in der Regel bestätigt. Das Kind reagiert
ursprünglich auf die mangelnde Empathie der
Eltern mit Wut. Wenn es die Erfahrung macht, dass
es auf seine Wut aversiv und abwehrend reagiert
wird, wird es sie sublimieren bzw. verdrängen.
Häufig droht sogar Liebes- und Objektverlust.
Diese Wut wird dann sukzessiv gegen das eigene
Selbst gerichtet und führt zu der negativen
Überzeugung, falsch und nicht liebenswert
zu sein. Das Kind resigniert und wird depressiv.
Die Entwicklungspsychologie von
Mahler hat wichtige Erklärungen der Narzissmusproblematik
erarbeitet, doch können sie im Zeitalter
der Säuglingsforschung nicht mehr ungebrochen
geteilt werden. Sie basiert noch auf der Triebtheorie
Freuds. Sowohl Triebtheorie als auch Mahlers Phasenmodell
werden insbesondere von Stern, einem Pionier der
Säuglingsforschung, in Frage gestellt und
zum Teil empirisch widerlegt.
Nach Stern (1992) und vielen anderen Säuglingsforschern
(s. Dornes, 1993) gibt es nicht den passiven,
undifferenzierten Säugling, der mit einem
Reizschutz versehen ist, im Lustprinzip lebt und
von seinen Es-Trieben gesteuert wird, wie noch
Freud annahm. Stern betrachtet die Triebtheorie
eher als hinderlich für eine Motivationstheorie,
insbesondere relativiert er die von Freud aber
auch von Reich (1989) betonte Rolle der Es-Triebe.
Stern nennt stattdessen eine Reihe von Motivationen
wie Explorationsverhalten, Suchen nach dem kognitiv
Neuen, die Lust an der Bemeisterung und Bindungsstreben.
Doch bevor diese Fragestellung genauer behandelt
wird, werden zunächst einige zentrale Ergebnisse
der Säuglingsforschung zusammengefasst.
In der von Stern beschriebenen
Interaktion ist der Säugling von Beginn an
Subjekt. Bereits im Alter von 2 Monaten (bis 6
Monate) entwickelt er ein Kern-Selbst,
ein erlebnishaftes Selbstempfinden. Es umfasst
die körperliche Gegenwart, das Handeln, den
Affekt und die Kontinuität. Der Säugling
erlebt, dass er von der Mutter körperlich
getrennt ist, dass jeder sein affektives Erleben
und seine ihm eigene Geschichte hat. Aus körperpsychotherapeutischer
Sicht ist dabei wesentlich, dass das Kern-Selbst
im Körper verankert ist.
Wie entwickeln sich nun in der präverbalen
Phase psychische Repräsentationen beim Säugling,
mit denen Erfahrungen gespeichert werden? Stern
bezeichnet sie als „generalisierte
Interaktionsrepräsentationen“
(Representations of Interactions that have been
Generalized, RIGs). (Stern, 1992, S. 143) Sie
enthalten vielfältige spezifische Erinnerungen,
z.B. den Akt des Stillvorgangs, in dem der Säugling
abspeichert, dass und wie die Mutter ihre Bluse
öffnet, wie sie ihn an die Brust legt, den
affektiven Zustand der Mutter, das eigene Empfinden
usw. Der Säugling repräsentiert psychisch
generalisierte Interaktionen z.B. in dem er den
Ablauf des Geschehens in Segmente unterteilt und
die Invarianten speichert. Dabei spielen die körperlichen
Erfahrungen und die nonverbalen Signale eine ganz
entscheidende Bedeutung. Die Körpersprache,
der Gesichtsausdrucks u.a. der Mutter hat für
den Säugling emotionalen Signalcharakter
(s. Dornes, 1993, S. 152 ff.) .
„RIGs resultieren aus dem unmittelbaren
Eindruck mannigfaltiger, realer Erfahrungen, und
sie integrieren die unterschiedlichen Handlungs-,
Wahrnehmungs- und Affekt-Attribute des Kern-Selbst
zu einem Ganzen.“ (Stern, 1992, S. 143-144)“...das
Selbst, das handelt, das Selbst , das fühlt,
und das Selbst, das den eigenen Körper und
dessen Handlungen auf seine ihm eigene Weise wahrnimmt
– sie alle werden zusammengeführt.“
(ebda, 144) Die körperliche Interaktion ist
ein wesentliches Element des Interaktionsprozesses,
z.B. wie die Mutter das Kind berührt, hält,
wiegt und bewegt.
In der Kommunikation zwischen Säugling und
Mutter/Bezugspersonen ist die „Musik der
Worte“, die Art und Weise, wie sich Mutter
und Säugling zueinander verhalten entscheidend.
Babys haben von Anfang an– noch ohne Sprache
- ein Bewusstsein, genau wie ihr Gegenüber
nach dem Motto: „Ich weiß, dass du
wahrnimmst, dass ich etwas weiß. In diesen
Interaktionen zwischen dem Säugling und den
primären Bezugspersonen findet eine Affekt-Abstimmung
(affect-attunement) statt. Die Eltern reagieren
auf die Gefühlsäußerungen des
Säuglings, in dem sie sie imitieren oder
in eine andere Modalität transformieren.
Die Metapher des Tanzes passt gut für diese
Interaktion. Ein Beispiel für eine gelungene
Affekt-Abstimmung: „ Ein neun Monate altes
Kind schlägt mit der Hand auf ein Spielzeug,
zunächst ein bisschen ärgerlich, dann
mit wachsendem Vergnügen und in einem bestimmten
Rhythmus. Die Mutter kommentiert das mit freudigem
Gesicht und mit einem „KAA-BAAM“,
wobei das langgezogene KAA zum Heben des Arms,
das BAM zum Fallen passt.“ ... (Dornes,
1993, S. 154) Die nonverbalen und körperlichen
Signale und Botschaften und wie sie von der Mutter
aufgegriffen werden, haben eine entscheidende
Relevanz. Das Kind schlägt einen Rhythmus,
die Mutter antwortet mit einem freudigen Gesicht
(Mimik) und mit einem stimmlichen Ausdruck (KAA
-BAMM) im vorgegebenen Rhythmus des Kindes. Dies
ist ein gutes Beispiel für empathische Feinabstimmung
Abstimmung“ (selective attunement), sie
beinhaltet Nachahmung und Anregung zugleich und
fördert Interesse und Neugier des Säuglings.
Wenn die Bezugspersonen hingegen das Kind manipulieren,
findet eine Fehlabstimmung (miss-attunement) statt.
Der Körperpsychotherapeut Downing (1996)
hat die These von angeborenen „affekt
–motorischen Schemata“ entwickelt,
die m.E. als subjektive Voraussetzung des Säuglings
in die RIGs eingehen. Sie sind angeboren und entfalten
sich erst durch die konkrete Interaktion mit den
primären Bezugspersonen. Affekt-motorische
Schemata sind zunächst vorgegebene Bewegungsmuster,
die der Säugling in die Interaktion mit den
Eltern einbringt. Dabei steht der körperliche
Charakter dieser Schemata im Vordergrund, es sind
zunächst motorische Bewegungen des Säuglings,
z.B. Ausgreifen der Arme, die affektiv getönt
werden. Wird dieses Ausgreifen seiner Ärmchen
von der Mutter oder dem Vater nicht beantwortet,
z.B. indem der eigene Arm oder das Gesicht zurückgezogen
wird, dann greift der Säugling ins Leere.
Wiederholt sich dies vielfach, wird er seine Arme
zurückziehen.
Diese physischen Interaktionen zwischen Kind und
Eltern hinterlassen Spuren, die im Körpergedächtnis
gespeichert werden. Downing unterscheidet zwischen
affekt-motorischen Verbindungs- und Differenzierungsschemata.
In den ersteren spiegeln sich Bindungs- und in
den zweiten Autonomiebedürfnisse wider. Downing
hat die affekt-motorischen Schemata zu seiner
Konzeption von Körper-Mikropraktiken (Downing,
2003) weiterentwickelt. Diese sind für Downing
verkörperte Fähigkeiten, dabei denkt
er an Aktivitäten wie Tennisspielen oder
einen Nagel mit einem Hammer einschlagen. Die
Körper-Mikropraktiken beinhalten
körperliche, affektive und kognitive Komponenten.
Im Unterschied zum einfachen Reflex, der eine
Reiz- Reaktion- Antwort darstellt, sind die Körper-Mikropraktiken
variabler und zielorientierter.
Die Erkenntnisse der Säuglingsforschung
haben weitreichende Konsequenzen für die
Narzissmustheorie. Das Phasenmodell von Mahler,
das von einem normalen Autismus und einer Symbiose
ausgeht, ist problematisch. Nach Stern können
diese Phasen empirisch nicht beobachtet werden.
Von Anfang an ist der Säugling auf den anderen
bezogen und kann bereits im Alter zwischen dem
2. und 7. Monat zwischen sich und dem anderen
differenzieren. Es gibt keine Phase, wo er die
Grenzen zwischen sich und der Mutter verliert
und symbiotisch mit ihr verschmolzen wäre.
Downing (1996, S. 169 ff.) nimmt zu der Auseinandersetzung
von Stern mit Mahler klärend Stellung, er
betrachtet Mahlers Objektbeziehungsperspektive
und Sterns Forschung als miteinander vereinbar.
An Mahlers Entwicklungstheorie verteidigt er die
fortschreitende Differenzierung von Selbst und
Objekt in der Kleinkindzeit, ohne ihre Begriffe
wie Autismus und Symbiose zu übernehmen.
Nach Stern gibt es keine spezifische Phase für
die narzisstische Entwicklung. Grandiosität
beim Kind kann für ihn durch eine Fehlabstimmung
(miss-attunement) zwischen Mutter bzw. primären
Bezugspersonen und dem Kind entstehen, wenn z.B.
die Mutter nur auf enthusiastische Äußerungen
des Kindes reagiert und diese verstärkt,
während sie exthusiastische- depressive-
Äußerungen unterdrückt oder verleugnet.
Oder, wenn die Mutter auf Grund mangelnder empathischer
Feinabstimmung keine affektive Bezogenheit zu
dem Kind herstellt, dann stellen sich beim Kind
Gefühle kosmischer Einsamkeit und schizoider
Einsamkeit ein. Die Gefühlsverleugnung, die
z.B. für Lowen das Hauptmerkmal narzisstischer
Störung darstellt, kann bereits im Altern
von 2-9 Monaten erfolgen, da der Säugling
bereits in diesem Alter regelmäßig
innere Gefühlsqualitäten (Affekte) erlebt.
Die narzisstische Entwicklung ist also nach der
Theorie der Säuglingsforschung Ausdruck einer
empathischen Fehlabstimmung (miss-attunement),
die Vitalitätsaffekte, z.B. die erwähnte
Wut werden von den Bezugspersonen nicht spiegelnd
und entwicklungsfördernd beantwortet. Dieser
Prozess vollzieht sich in wesentlichen Teilen
auch auf der non-verbalen und körperlichen
Ebene. Es erfolgt keine elterliche Rückenstärkung
für aversive Gefühle wie Wut, Ärger
oder auch
Traurigkeit, sondern vielleicht nur für sogenannte
positive Gefühle wie Freude, Wohlbefinden,
Lächeln etc. Narzisstische Fehlentwicklungen
sind weniger Folge traumatischer Erfahrungen als
von Mikrotraumen, die durch Zurückweisungen
oder unangemessene Reaktionen auf Resonanz- und
Bindungsbedürfnisse entstehen. .„Unsichere
Bindung ist das Ergebnis chronischer, aber häufig
ganz undramatischer Zurückweisung oder inkonsistenter
Beantwortung von Bindungs- bedürfnissen und
ist nicht in erster Linie auf grobe Traumatisierungen
zurückzuführen. Es steht nicht mehr,
wie z.B. noch beim frühen Spitz und bei Bowlby,
der Verlust des Objektes im Vordergrund, sondern
dessen relative Unverfügbarkeit trotz Anwesendheit.“
(Dornes, 2000, S.84)
Aus entwicklungspsychologischer Perspektive spielt
die Herausbildung von Schamgefühlen, eine
weitere wichtige Rolle bei der Genese des Narzissmus.
Erwachsene Narzissten schämen sich in der
Regel ihrer Gefühle, besonders ihrer Trauer
und ihrer Bedürftigkeit. Kinder, die mit
ihrem Spiegelbild etwa ab dem 15. Monat konfrontiert
werden, zeigen Vorläufer selbstreflexiver
Schamreaktionen. Erst im Alter von 2 Jahren treten
Schamreaktionen als Ausdruck eines entwickelten
Selbst auf (Hilgers,1997, 194 ff.). Die Herausbildung
der Scham hat in einer gesunden kindlichen Entwicklung
eine entwicklungs- und identitätsfördernde
Funktion, doch in der narzisstischen Sozialisation
wird sie zu einem entscheidenden Hindernis für
den Gefühlsausdruck.
Kritische
Anmerkungen zur Säuglingsforschung
Aus körperpsychotherapeutischer Sicht können
auch kritische Anmerkungen gegenüber einigen
Prämissen der Säuglingsforschung gemacht
werden, da bei ihr die Tendenz vorherrscht, die
psychische Entwicklung des Kindes primär
aus der Interaktion mit den nahen Bezugspersonen
abzuleiten. Demnach wird sie entscheidend von
Außen, in der Regel den Eltern, determiniert.
Der Tatsache, dass das Kind auch ein Naturwesen
ist und energetischen Pulsationsbewegungen folgt,
wird allenfalls am Rande beachtet. Sein Körper
wird zwar immer wieder erwähnt aber nicht
in seiner Tiefe begriffen. Diesbezüglich
sind die Reichianischen Erkenntnisse z.B. über
Lust/Unlust, Selbstregulation, das energetische
Prinzip, seine Erkenntnis vom Muskelpanzer und
das Konzept G. Boyesens (Boyesen, G., M.L., 1987,
S. 99 ff. ) vom Emotional-Vasomotorischen Zyklus
unverzichtbar. In diesem Zyklus vollziehen sich
affektive Erregungszustände auf drei Schichten
des Organismus:
a) der vegetativen (endodermalen) Schicht: autonome
Prozesse wie Bluthochdruck-, Herzfrequenzveränderungen,
Reaktionen der Verdauungsorgane, Stoffwechseländerungen,
hormonelle Prozesse;
b) der willkürlich und unwillkürlichen
Muskelaktionen (mesodermal): mimische und gestische
Äußerungen, Haltungs- und Handlungsveränderungen;
c) der Schicht der Wahrnehmungsorgane, der neuronalen
Strukturen, der Kognitionen und bewusst erlebten
Emotionen (ektodermal): psychische und kognitive
Prozesse.
Die Neurose verkörpert sich auch in muskulären
Spannungen und vegetativen Störungen,
die sich bereits beim Säugling entwickeln
können.
Die Arbeiten der körperorientierten Babytherapeuten
(s. Harms, 2000) machen manifest, das sich bereits
prä- peri- und postnatale Störungen
in der Mutter -Kind -Beziehung psychisch ausdrücken
(ebda, S. 189 ff.) Die Babytherapeuten haben bei
ihren kleinen Patienten eine Reihe von somatisch-psychischen
Symptomen wie: Blockierungen des Zwerchfells,
der Schultermuskeln sowie des Gewebe- und Muskelbereichs
u.a. des Augensegments
diagnostiziert. Diese Symptome verweisen deutlich
auf die Verkörperung von Interaktionsstörungen
und von Gefühlen. Bereits ein Fötus
hat Affekte, er kann schon Angst erleben, wie
Grof (1985), Janus (2000) u.a. nachgewiesen haben.
Der Säugling ist nicht nur ein soziales Wesen
– „self –with- other“
(Stern) – sondern auch ein Naturwesen und
eine bioenergetische Einheit. Es treten also auch
zwei Organismen in Interaktion. Der Emotional
-Vasomotorische Kreislauf vollzieht sich sowohl
beim Säugling als auch bei seinen Bezugspersonen.
Störungen in der Affektabstimmung führen
zu Störungen im psychischen, muskulären
und vegetativen Bereich. Kontraktion, Erschlaffung
der Muskulatur (Hypo- oder Hypertonie), Veränderung
des Atemrhythmus usw. Gefühle haben körperliche
Korrelate, wie in der Emotionsforschung eindeutig
belegt wird (s. Geuter, Schrauth, 2001, S. 4 ff.).
Das Sternsche Modell von den RIGs kann aus körperpsychotherapeutischer
Sicht auf die muskuläre und vegetative Ebene
ausgeweitet werden. Das Modell vom Emotional-vasomotorischen
Kreislauf sollte wiederum zu einem Interaktionsmodell
weiter entwickelt werden, z.B.: der Säugling
schreit, drückt Wut aus (psychisch), muskulär
kommt es zu einer Kontraktion und Anspannung in
den beteiligten Muskeln, der Muskeltonus steigt,
vegetativ kommt es zu einer starken Innervation
des Sympathikus. Eine empathische Feinabstimmung
von Seiten der Bezugspersonen ist dann gelungen,
wenn sie die Wut des Kindes akzeptieren, dies
verbal und körperlich ausdrücken und
dem Kind das Gefühl zu geben, dass es mit
seiner emotionalen Äußerung angekommen
ist. Durch das Ausdrücken ihrer Gefühle
auf den verschiedenen Ebenen können sowohl
das Kind als auch die Eltern entspannen. Beide
Emotional-Vasomotorischen Kreisläufe wären
dann geschlossen.
Die Ergebnisse der Säuglingsforschung und
die Erfahrungen der körperorientierten Babytherapien
müssten miteinander verbunden werden. Hierin
liegt ein großes, erst ansatzweise genutztes
Potenzial.
Körperpsychotherapie
mit narzisstischen Klienten/Patienten
Ein Grundproblem in der therapeutischen Arbeit
mit narzisstischen Persönlichkeitsproblemen
besteht nach meiner Erfahrung darin, sein Gegenüber
emotional wirklich zu erreichen. Auch die intensivsten
körperpsychotherapeutischen Interventionen
können verpuffen, wenn sie nicht durch den
therapeutische Kontakt getragen sind .und die
Klientin in ihrer Welt der Projektionen, Idealisierungen
und Abwertungen verbleibt. Wenn sie mit ihren
Schamgefühlen in Kontakt kommt, die Schutzschicht
der emotionalen Isolation überwindet und
auch Gefühle wie Einsamkeit, Trauer, Ohnmacht
u.a. zulassen kann, ist schon ein merklicher Therapiefortschritt
erreicht. Die Beziehungsarbeit ist tiefenpsychologisch
fundiert und bezieht neben Übertragungs-
und Gegenübertragungsgefühlen, auch
die Ich-Du-Beziehung und die somatische und psychische
Resonanz mit ein. Die Betonung der Beziehungsarbeit
in der Körperpsychotherapie ist deshalb von
besonderer Wichtigkeit, weil sie sowohl von Reich
in seiner Spätphase als auch von Lowen und
z.T. auch von G. Boyesen vernachlässigt wurde
(s. Thielen, 1994, S.10 ff.).
Ein weiterer psychotherapeutischer Schwerpunkt
stellt die Arbeit mit der Aggression dar. Aggression
im Sinne von „aggredi“ –(lat.
hinzugehen,) und nicht im Sinne von Feindseligkeit.
Das Dilemma des narzisstischen Menschen besteht
darin, dass er sich nicht aus seiner narzisstischen
Isolation heraus und zu den anderen Menschen hinbewegen
kann, sondern im Rückzug bleibt. Deshalb
ist es ein wesentliches Ziel, diese Hinbewegung
zu befördern (Busch, 2002). Zudem hatten
die frühkindlich erlebten Enttäuschungen
Enttäuschungswut zur Folge, die aber von
den Eltern emotional nicht angenommen sondern
eher unterdrückt wurde. Die sich daraus gebildete
Aggressionshemmung gilt es in der Arbeit angemessen
zu lockern. Anhand einer Fallvignette möchte
ich – zwangsläufig in groben Zügen
– mein körperpsychotherapeutisches
Vorgehen veranschaulichen.
Fallbeispiel
Bettina 2) war zu Beginn der Therapie Mitte 30
J. Ihr Freund hatte sie nach einer halbjährigen
Beziehung verlassen. Sie suchte die Therapie wegen
folgender Symptome auf: Depressionen, Selbstvorwürfe,
Selbstwertschwankungen, Zwangsgrübeln, Schuldgefühle,
Schlafstörungen und Appetitlosigkeit. Über
einen Zeitraum von mehreren Wochen hatte sie Suizidgedanken.
Sie bekam anfangs auch begleitend ein Psychopharmakon.
Kurzbiografie: Sie war das zweite Kind
und hatte eine ältere Schwester. Die Eltern
lebten auf Initiative der Mutter zeitweise getrennt,
doch der Vater hielt massiv an der Beziehung fest.
Er setzte die Mutter unter Druck und konnte schließlich
ihre Rückkehr erzwingen. Das Verhältnis
von Bettina zu ihrem Vater war seit ihrer frühen
Kindheit sehr schwierig. Sie fühlte sich
von ihm gedemütigt, missachtet und ungeliebt.
Ihrer Einschätzung war ihr Vater selbstbezogen,
egoistisch und z.T. auch sadistisch. Ihre Schwester
und sie wurden rigiden Regeln des Verhaltens und
des Aussehens unterworfen. Z.B. erlebte sie folgende
Mikrotraumen: sie wurde in Kleider gesteckt, die
ihr überhaupt nicht gefielen, gegen ihren
Willen wurden ihr die Haare kurz geschnitten,
sie wurde abgewertet und beschimpft. Ihr Verhältnis
zu ihrer Mutter war hingegen positiv. Sie fühlte
sich von ihr geliebt, unterstützt und bestätigt.
Doch aus heutiger Sicht wurde sie von ihrer Mutter
narzisstisch besetzt, idealisiert und im Machtkampf
der Mutter gegen den Vater als ihre Bündnispartnerin
instrumentalisiert. Sie erlebte in ihrer Kindheit
folgende Dualität, Abwertung und Demütigung
durch den Vater, positive Zuwendung und Idealisierung
von der Mutter.
Bettinas Narzissmus bestand nicht darin zu glauben,
dass sie leistungsmäßig überall
die Beste sei, sondern sie wollte ihre Zweierbeziehungen
nach ihren Idealvorstellungen formen. Sie war
sehr selbstbezogen und alles sollte so laufen,
wie sie es haben wollte. Sie hatte die Überzeugung,
dass die Männer letztlich doch machen, was
sie will. Wenn es nicht nach ihren Vorstellungen
lief, konnte sie diesen Zustand nicht ertragen.
Vor allem wollte sie die Trennung, die ihr Freund
initiiert und ausgesprochen hatte, nicht akzeptieren.
Sie entwickelte einen weiteren Glaubenssatz: “
Wenn ich nicht geliebt werde, nicht das bekomme,
was ich will, dann bringe ich mich um.“
Ihre Selbstwertkrise hatte traumatische Ausmaße
angenommen, auf deren zum Boden und Höhepunkt
sie einen halbherzigen, mehr angedeuteten, Suizidversuch
unternommen hatte.
In der körperpsychotherapeutischen
Arbeit ging es auf der Basis der Kenntnis ihrer
Biografie zunächst um den Aufbau einer tragfähigen,
vertrauensvollen und produktiven Arbeitsbeziehung.
Sie fasste relativ schnell Vertrauen und entwickelte
zunächst eine positive Übertragungsbeziehung
zu mir. Der Therapeut hatte die Rolle des guten
Objektes, des guten, idealen Vaters.
Auf Grund ihrer starken Depressionen schlug ich
ihr zu Beginn der Körperarbeit bioenergetische
Erdungsübungen (Groundingübungen) (s.
Lowen, 1980 ) vor. Sie redete zunächst relativ
viel, wirkte sehr kognitiv kontrolliert und wenig
zentriert und geerdet. In der Regel habe ich gute
klinische Erfahrungen mit Groundingübungen
bei Depressionen, da sie die starke Aggressionshemmung
lockern und ersten körperlichen Zugang zu
den unterdrückten bzw. verdrängten und
abgespaltenen Aggressionen herstellen können.
Sie machte diese Übungen auch und erlebte
tatsächlich eine bessere Erdung, der Kontakt
zu ihren Beinen und Füssen wurde besser.
Doch mit ihren Aggressionen kam sie nicht in Kontakt,
stattdessen fühlte sie sich in erster Linie
angestrengt. Offensichtlich war ihre Abwehr gegen
ihre tiefverdrängten Aggressionen noch zu
stark. Im weiteren Verlauf nahm ich ihr Bedürfnis
nach Entspannung und ihren Wunsch, ihren inneren
Druck mehr loslassen zu wollen, auf und schlug
ihr eine biodynamische Exit -Massage vor. Sie
erlebte dabei den Zustand einer dynamischen Tiefenentspannung.
Sie hatte nach der Massage das Gefühl, dass
ihr Körper, der sich vorher schwer und träge
angefühlt hatte, leichter und energievoller
geworden war. Ich wandte die Massagen häufiger
an mit dem Ergebnis, dass ihre Schlafstörungen
und ihre depressive Schwere nachließen.
Während der Massage tauchten auch zentrale
Themen wie: ihr Selbstwertgefühl, ihr Verhältnis
zu ihrem Vater, ihrem Ex-Freund, ihr Verhältnis
zu ihrer Mutter u.a. auf. Die verschiedenen biodynamischen
Massagen haben nicht nur ihr Widerstand bzw. ihr
Abwehr „geschmolzen“, sondern gaben
ihr auch eine Form von Halt (Containment) und
Sicherheit. Sie bekam durch sie wieder ein Gefühl
für ihre Körpergrenzen und erlebte körperliches
Wohlbefinden. Die Massagen wirkten nachnährend,
sie fühlte sich dabei vom „idealen
Vater“ angenommen und liebevoll versorgt.
Im weiteren Verlauf kam sie immer mehr in Kontakt
mit ihren verdrängten Gefühlen, auch
mit ihren tiefverdrängten Aggressionen. Sie
wurde wütend auf ihren Vater und bekam Racheimpulse.
Um diese Wut auch körperlich mehr ausdrücken
zu können, schlug ich ihr ein körperorientiertes
Rollenspiel vor. Ich spielte die Vaterfigur, wir
standen uns gegenüber und gaben uns die Hände.
Sie bekam die Aufgabe, den Vater mit ihren Händen
wegzudrücken. Nach anfänglichem Zögern
entwickelte sie mehr Kraft, die sich zunehmend
zur Wut steigerte und gegen ihren Vater richtete.
Es war für sie sehr wichtig, diese Wut auch
körperlich zu spüren, eine entsprechende
Ausdrucksform zu finden und sie objektbezogen
richten zu können.
In der weiteren Entwicklung konnte sie auch Wut
und Ärger auf ihre Mutter zulassen, ihr wurde
bewusst, dass sie von ihr als Bündnispartnerin
instrumentalisiert worden war. Ihr gegenüber
entwickelte sie mehr Abgrenzung und Autonomie.
Ihr wurde auch zunehmend bewusst, dass sie von
ihrer Mutter idealisiert worden war, da sie das
Leben führte, was sich die Mutter eigentlich
gewünscht hatte. Aber auch sie hatte ihre
Mutter in ihrer Kindheit idealisiert. Im Unterschied
zum Vater war sie für sie früher nur
die Gute, während sie jetzt lernte, auch
ihre Schattenseiten zu sehen.
In Form von Introjekten hatte sie den Mechanismus
der Idealisierung und der Abwertung verinnerlicht
und vor allem in ihren nahen Beziehungen angewandt.
Mit Hilfe von „emotionaler Ausdrucksarbeit“
konnte sie auch Gefühle wie Trauer, Schmerz,
Einsamkeit und Bedürftigkeit zulassen. Zu
dieser Gruppe körperpsychotherapeutischer
Interventionen gehören Übungen und Techniken
zur Förderung des emotionalen Ausdrucks.
Dazu gehören bioenergetische, biodynamische,
vegetotherapeutische Übungen. Röhricht
(2000) hat eine Vielzahl effektiver körperpsychotherapeutischer
Techniken aus dieser Gruppe zusammen gestellt.
In diesem Kontext spielt die Atemarbeit eine besondere
Rolle. In der Regel wird die flache Atmung zur
Gefühlsunterdrückung eingesetzt. Durch
vielfältige Atemtechniken, bei denen sowohl
auf die Ein- als auch auf die Ausatmung fokussiert
werden kann, kann eine Emotionalisierung der PatientIn
befördert werden.
Nach jeder Körperübung erfolgt eine
verbale Aufarbeitung, um sowohl das emotional
Erlebte auch kognitiv zu erfassen, als auch Muster
und Mechanismus erkennen und eine biografische
Zuordnung vornehmen zu können.
Doch nun zurück zu dem Fallbeispiel, um es
verkürzt zu sagen, konnte Bettina mit meiner
therapeutischen Unterstützung herausarbeiten,
dass sie sich auf Grund ihrer kindlichen Erfahrungen
mit ihrem demütigenden Vater als Opfer erlebt
hatte. Zunächst als Opfer ihres Vaters, auf
den sie ohnmächtig wütend war und den
sie als Kind gehasst hatte, dann als Opfer ihres
Freundes, der sie verlassen hatte. In ihrer massiven
Selbstwertkrise bewertete sie das Verlassenwerden
als ihr Versagen. Als Konsequenz bestrafte sie
sich selbst, indem sie sich massiv abwertete –
bis hin zum Suizidversuch – und nicht mehr
leben wollte. Ihre narzisstische Omnipotenz äußerte
sich in der Illusion:“ ich schaffe es schon,
wenn ich es nur will und fest daran glaube. Ich
gewinne ihn zurück.“ Dabei konnte sie
den Anderen, ihren Freund und seine Verletzungen
nicht sehen und sein Nein und seine Abgrenzung
nicht akzeptieren. Sie schämte sich auch,
dass sie es nicht geschafft hatte, die Trennung
zu verhindern.
Durch die Realitätskonfrontation und empathische
Konfrontationen in der Therapie wurde ihr aber
auch schrittweise ihr eigener Anteil an der Beziehungskrise
bewusst. In der Phase ihrer ersten Verliebtheit
hatte sie eine mehrwöchige, bereits länger
geplante Auslandsreise mit einem guten Freund
unternommen, obwohl ihr damaliger Partner sie
gebeten hatte, die Reise nicht zu unternehmen
bzw. zu verkürzen. Sie hatte sie trotzdem
gemacht, weil sie z.T. unbewusst das Beziehungskonzept
hatte, auch in intimen Beziehungen möglichst
autonom zu bleiben und die Überzeugung zu
pflegen, dass sich die Männer nach ihren
Bedürfnissen zu richten hätten. Diese
starke Betonung ihrer Autonomie hatte sie von
ihrer Mutter übernommen, die ihr einerseits
dazu riet und andererseits in ihrer Ehe selbst
ein schlechtes Vorbild war, da sie sich von ihrem
Mann abhängig gemacht hatte.
In der Endphase der Therapie, als sich ihr Selbstwertgefühl
wieder mehr stabilisiert und sie die Trennung
verarbeitet hatte, lernte sie ihren neuen Partner
kennen, mit dem sie zusammen zog und dann ein
Kind bekam. Als Lehre aus der gescheiterten Beziehung
hat sie sich stärker eingelassen. Die Widersprüche
zwischen ihnen versuchen sie offen auszutragen
und eine Art Streit- und Widerspruchskultur in
ihrer Beziehung zu entwickeln. Sie verfällt
phasenweise noch in abgeschwächter Form in
ihr Muster der Idealisierung und der Abwertung,
doch es ist ihr bewusster und sie hat Alternativen
dazu entwickelt. Mit Hilfe der Therapie war sie
auch in der Lage, ihre Beziehung zu ihren Eltern
zu entspannen, dass sie auch ihrem Vater erwachsen
gegenüber treten kann. Ihren kindlich bedingten
Hass hat sie weitgehend verarbeitet, doch zu ihrem
Vater hält sie eine freundliche Distanz.
Sie entwickelte Selbsthumor, sah sich selbstkritischer
und ein deutlich gewachsenes Selbstwertgefühl.
Bettinas starke Aggressionshemmung war Ausdruck
ihres unterentwickeltes affekt-motorisches Schemata
(s. Downing, 1996, S 191 ff.) Sie hatte für
Wut kaum motorische Ausdrucksformen. Das Erlernen
von aggressiven Bewegungen z.B. das Drücken
waren produktiv, um dieses unterentwickelte Schema
wieder zu aktivieren. In ihrer Geschichte war
das Familiensystem so gestaltet, dass sie einem
ständigen Druck ausgesetzt war, das affekt-motorische
Schema für Wut im gehemmten Zustand zu belassen.
Durch die wiederholte Aktivierung dieses Schemas
in der Therapie z.B. durch die körperorientierten
Rollenspiele wird auch ein neurophysiologischer
Prozess in Gang gesetzt, bei dem neue synaptische
Verbindungen hergestellt werden. Übungen
und Wiederholungen spielen eine wichtige Rolle,
damit diese neuen Verbindungen vertieft, verstärkt
und automatisiert werden. Nach den neuen neurobiologischen
Erkenntnissen der Alexithymieforschung (Damasio,
2000), ist das Gehirn des Alexithymen nicht in
der Lage, die Körpersignale in Verbindung
mit Gefühlen zu bringen. Die Fähigkeit
muss – auch mit Hilfe von Körperübungen-
neu gelernt werden. Die Körpersignale, die
z.B. durch bioenergetische oder biodynamische
Übungen entstehen können wie z.B. Anspannung,
Wärme, Vibration, Entspannung u.a. werden
schrittweise mit Gefühlen in Verbindung gebracht.
Dieser Transformationsprozess führt auch
zu synaptischen Verbindungen mit den Gefühlsregionen
wie der Amygdala im Gehirn.
Die Vielfalt der körperpsychotherapeutischen
Interventionen lässt sich, wie am Fallbeispiel
veranschaulicht, in vier Gruppen unterteilen:
1.) Biodynamische Massagen: sie regen die Selbstregulation
an und aktivieren den Emotional-vasomotorischen
Zyklus. Diese Form der systematischen körperlichen
Berührung kann narzisstische Klienten mit
ihren abgespaltenen bzw. verdrängten Gefühlen
und ihrem Selbst in Kontakt bringen und unbewusstes,
dynamisches Material freisetzen.
2.) Emotionale Ausdrucksarbeit: körperpsychotherapeutische
Übungen und Techniken aus den verschiedenen
Richtungen der Körperpsychotherapie wie:
Vegetotherapie nach Reich, Bioenergetik, Biodynamik,
Core-Energetik, Biosynthese, Hakomi u.a. zur Förderung
des gehemmten emotionalen und somatischen Ausdrucks.
3.) Formen des „Holdings“ oder „Containments“:
diese Interventionen geben dem Klienten Halt und
verhelfen ihm/ihr dazu, die eigenen Gefühle
zu halten, von ihnen nicht überflutet zu
werden. Es hat häufig nachnährenden
Charakter.
4.) Körperorientierte Rollenspiele: biografisch
bedingte Grundkonflikte und Konflikte können
reinszeniert und lösungsorientiert ausgedrückt
werden. Dabei spielt die körperliche Interaktion
und Ausdruck eine wichtige Rolle.
Diese Interventionsgruppen wurden in einer kleinen
qualitativen, empirischen Studie untersucht und
ihre Wirksamkeit bei narzisstischen Störungen
überprüft (s. Stehle, Körber, 2002
S. 144 ff.)
Mit ihren vielfältigen Interventionsmöglichkeiten
auf der nonverbalen und somato -psychischen verfügt
die Körperpsychotherapie nicht nur über
ein hochwirksames Instrumentarium, sondern auch
über einen wichtigen Vorsprung gegenüber
Psychotherapieverfahren, die primär verbal
arbeiten. Gerade auch bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen
und – problemen ist ein körperorientiertes
psychotherapeutisches Vorgehen sehr erfolgversprechend.
Fußnote: 1) Der Artikel
ist die überarbeitete Fassung meines Eröffnungsvortrages
auf der 9.GBP-Fachtagung zu dem Thema „Trauma
& Kränkung. Schicksal und Entwicklungschance“
am 1.10.2004 in Schermau. Er basiert inhaltlich
z.T. auf den Artikeln: „ Narzissmus –
Körperpsychotherapie zwischen Beziehungs-
und Energiearbeit.“ (Thielen, Manfred, Hrsg.,
Narzissmus. Körperpsychotherapie zwischen
Energie und Beziehung, Berlin 2002, S. 7 –26)
und auf dem Artikel „Körperpsychotherapie
bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen“,
der voraussichtlich im Januar 2006 in: Marlock,
Gustl, Weiss, Halko, Handbuch der Körperpsychotherapie.
Schattauer-Verlag erscheinen wird. Hier erfolgt
eine systematische und historische Abhandlung
der Thematik.
2.) Der Name wurde vom Autor natürlich verändert
.
Copyright beim Autor. Der Artikel
ist im Journal der Gesellschaft für Biodynamische
Psychologie/Körperpsychotherapie
(GBP e.V.), 10 Jahre GBP e.V:, Trauma und Kränkung.
Beiträge der 9.Fachtagung der GBP e.V. in
Schermau 1.-3.10.2004.
Literaturliste:
Altmeyer, Martin, Narzissmus und Objekt. Ein intersubjektives
Verständnis der Selbstbezogenheit, Göttingen
2000;
Boyesen, Gerda, Über den Körper die
Seele heilen. Biodynamische Psychologie und Psychotherapie,
München 1987;
Boyesen, Gerda & Mona-Lisa, Biodynamik des
Lebens, Essen 1987;
Busch, Thomas, Narzissmus - Selbstentfremdung
und leibseelische Wiederbelebung des Selbst, in:
Thielen, Manfred (Hrsg.), Narzissmus. Körper-Psychotherapie
zwischen Energie und Beziehung, Berlin 2002; (Veränderte
Neuauflage von: Verein für Integrative Biodynamik
(Hrsg.), Narzissmus. Körperpsychotherapie
zwischen Energie und Beziehung. Berlin 1997);
Busch, Thomas, Charakter und Persönlichkeit.
Aspekte des narzisstischen Persönlichkeitsstils.
Schriften zur Fort- und Weiterbildung des Instituts
für Körperpsychotherapie Berlin, unveröffentl.
Manuskript, Berlin 2000;
Damasio, Antonio R., Ich fühle, also bin
ich, München 2000;
Dornes, Martin, Der kompetente Säugling,
Frankfurt/M. 1993;
Dornes, Martin, Die emotionale Welt des Kindes,
Frankfurt /M. 2000;
Downing, George, Körper und Wort in der Psychotherapie,
München 1996;
Downing, George, Early Affect Exchance And The
Body, unveröffentl. Manuskript. 2003;
Freud, Sigmund, Zur Einführung des Narzissmus
(1914), Studienausgabe Bd. III, Frankfurt/M. 1982;
Geuter, Ulfried, Deutschsprachige Literatur zur
Körperpsychotherapie. Eine Bibliografie,
Berlin 2002;
Geuter, Ulfried; Schrauth, Norbert, Emotionen
und Emotionsabwehr als Körperprozess, Psychotherapie
Forum, 9, 4-19, 2001;
Grof, Stanislaw, Geburt, Tod und Transzendenz.
Neue Dimensionen in der Psychologie,München
1985;
Hilgers, Scham. Gesichter eines Affekts, Göttingen
1997;
Janus, Ludwig, Der Seelenraum des Ungeborenen.
Pränatale Psychologie und Therapie, Düsseldorf
2000;
Jacoby, Mario, Individuation und Narzißmus.
Psychologie des Selbst bei C.G. Jung und H. Kohut,
München 1985;
Johnson, Stephen M., Der narzisstische Persönlichkeitsstil,
Köln 1988;
Kernberg, Otto, Borderline-Störungen und
pathologischer Narzissmus, Frankfurt/M 1993 (7.
Aufl., 1983 1.Aufl.);
Kohut, Heinz, Narzissmus.. Eine Theorie der psychoanalytischen
Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen,
Frankfurt 1992 ( 8.Aufl., 1976 1.Aufl.);
Lasch, Christopher, Das Zeitalter des Narzissmus.
Gütersloh, 1982;
Lowen, Alexander, Bio-Energetik, Therapie der
Seele durch Arbeit mit dem Körper, Reinbek
bei Hamburg 1980;
Lowen, Alexander, Narzissmus. Die Verleugnung
des wahren Selbst, München 1986;
Mahler, Margret S., Symbiose und Individuation.
Bd 1: Psychosen im frühen Kindesalter, Stuttgart
1979;
Mahler, Margret S./Pine, Fred/Bergmann, Anni,
Die psychische Geburt des Menschen. Symbiose und
Individuation, Frankfurt/M 1992 (1980 1.Aufl.);
Reich, Wilhelm, Charakteranalyse, Köln 1989
(1933 1.Aufl.);
Röhricht, Frank, Körperorientierte Psychotherapie
psychischer Störungen, Göttingen, Bern,
Toronto, Seattle 2000;
Sachse, Rainer, Histrionische und Narzisstische
Persönlichkeitsstörungen, Göttingen,
Bern, Toronto, Seattle 2002;
Saß, H., Wittchen, H.-U.& Zaudig M.
Houben I., Diagnostisches und Statistisches Manual
Psychischer Störungen: DSM-IV TR, Göttingen,
Bern, Toronto, Seattle 2003.;
Stehle, Sabine/Körber, Senta, Körperpsychotherapie
aus der Sicht ehemaliger KlientInnen - Zentrale
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über
Integrative Biodynamik, in: Thielen, Manfred (Hrsg.),
Narzissmus. Körper-Psychotherapie zwischen
Energie und
Beziehung, Berlin 2002;
Stern, Daniel, Die Lebenserfahrung des Säuglings,
Stuttgart 1992;
Thielen, Manfred, Zwischen Röhrentierchen
und Bewusstseinswesen - das Menschenbild in der
Körperpsychotherapie, in: Verein für
Integrative Biodynamik (Hrsg.), Körperpsychotherapie
zwischen Lust- und Realitätsprinzip, Oldenburg
1994;
Thielen, Manfred, Narzissmus- Körperpsychotherapie
zwischen Beziehungs- und Energiearbeit, in: Thielen,
Manfred (Hrsg.), Narzissmus. Körper-Psychotherapie
zwischen Energie und Beziehung, Berlin 2002.
Thielen, Manfred, Bausteine einer körperbezogenen
Entwicklungspsychologie, Hauptvortrag auf dem
2. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Körperpsychotherapie, 18.-21.9.03; unveröffentl.
Manuskript 2003;
BEACHTUNG UND INTERSUBJEKTIVITÄT.
Die neuen Aufzeichnungstechniken der modernen
Säuglingsforschung halten den multimodalen
Charakter der frühen Interaktionen zwischen
Mutter und Säugling fest. In der Komplexität
der Darstellung der Interaktion bleibt der Bedeutungszusammenhang
der Beachtung unberücksichtigt. Vielleicht
hatten die Forscher Bedenken, dass ein Rekurs
über Beachtung die zahlreichen präzisen
und wahrnehmbaren Beobachtungen verwässert
und banalisieren könnte. Vielleicht steht
die Darstellung des Austauschs von Beachtung den
experimentellen und zu beobachtenden Tatsachen
im Wege und ist selbst nicht einer wissenschaftlichen
Präzision zu unterwerfen. Vielleicht folgt
das so wertvolle Material der Säuglingsforschung
selbst positivistischen Spur? Wie auch immer...
Studieren wir die Ergebnisse der
modernen Säuglingsforschung, dann finden
wir, dass zum einen der Begriff Mag der Begriff
Beachtung keine Beachtung finden, aufgewiesen
aber sehr vielfältige Belege, mit deren Hilfe
die Entwicklung des Selbstgefühls (Selbsterleben)
beschrieben wird: die frühen Prozesse des
„Spiegelns, der empathischen Zuwendung und
des inactments“, eines motorisch-handlungsbezogenen
Austauschs zwischen Mutter und Säugling (Stern,
1992; Dornes 2000). All diese Untersuchungen zeigen
uns die Kompetenz des Säuglings, der in der
zwischenmenschlichen Interaktion kompetenter Teilnehmer
ist und hierbei über ein subtiles Repertoire
von mimischen, lautlichen und gestischen Verhaltensweisen
verfügt, mit denen er den Eltern seine Befindlichkeit
signalisiert und gleichzeitig deren Interaktionangebote
- beeinflusst. Wit könnten sagen, dass der
Säugling in jedem Fall von Beginn an den
Prozess gegenseitiger Aufmerksamkeit und interpersonellen
Erlebens und somit sicher auch den Austausch von
Beachtung „mitzusteuern“ in der Lage
ist.
Narzissmusstudien zeigen uns,
dass die Wahrnehmung des anderen ein Austauschprozess,
ein interpersonell-verbaler, in den ersten Lebensmonaten
wesentlich ein nonverbal - körperbezoger
Austausch ist (Kohut 1993, Petzold 1995, Volkan/Ast,
1994 uvam). Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung
können Säuglinge, Kinder und Erwachsene
verbal und nonverbal beispielsweise über
Berührung, Körperkontakt und Bllcikkontakte
erfahren und austauschen (Busch, 2004). Ein Mangel
an Beachtung kann - aus der Gesamtsicht des Leibes
- zu emotionalem Rückzug, der Einschränkung
des Selbsterlebens- und des Körpererlebens
führen. Verarbeitungsformen, die sich über
Formen der Entwertung und der narzisstischen Kränkung
des Selbst des betroffenen Menschen eine der Entwertung
durch andere Menschen kennen wir seit Wilhelm
Reich (1972) und dessen Studien zur Charakteranalyse.
Bei Alexander Lowen (1984) führen wesentliche
Mängel an Beachtung und Liebe, verbunden
mit frühen Erfahrungen der Demütigung
und Entwertung zur Unterdrückung und Verzerrung
der vitalen Gefühlswelt (Gefühlskälte)
- und im weiteren Sinne zu Formen des „falschen
Selbst“ sowie zu einer Überbetonung
von Macht, Ichbezogenheit. und einem „Image“.
Untersuchungen über den Zusammenhang von
Beachtung, einer sichere Bindung und die Entwicklung
der Fähigkeit zur Empathie bei Einjährigen
lassen sich ferner auch in der Bindungsforschung
finden. Auch bei Lichtenberg (1999) finden wir
Beachtung nicht im Sinne des Wortes, aber doch
sinngemäss in den 5grundlegenden Motivationssystemen.
Diese bilden sich im Kontext des Austauschs von
Beachtung, Anerkennung und dem „intersubjektiven
Spiegel“ aus: gemeint sind die elementaren
und physiologischen Motivations- und Bedürfnisebenen
(1.) die Bindungsbedürfnisse (2.) des Gehalten-Seins,
des Körperkontaktes, der Nähe und Distanz;
die Bedürfnisse der Neugier und Selbstbehauptung
(3); der Sexualität (4.) und des aversiven
Verhaltens – gemeint ist das Bedürfnis
der Abneigung und Abgrenzung. Vermittelt wird
ein umfassendes Verständnis einfühlsamer
Wahrnehmung, wie wir es aus den humanistischen
Ansätzen der gesprächs- bzw. der Gestalttherapie
kennen, wobei der empathisch-introspektiven Einstellung
und der gemeinsamen Nachforschung des Erlebens
des Klienten besondere Bedeutung beikommt.
BEACHTUNG UND ANERKENNUNG.
GESUNDER UND PATHOLOGISCHER NARZISSMUS.
Beachtung und Anerkennung sind
wesentlicher Teil liebevoller Beziehungen und
das beste Mittel zur Pflege der Liebe, sagen Paartherapeuten
(Willi, 2004) und Glücksforscher (Kast, 2004)
gleichermassen. Beachtung und Anerkennung „gerinnen“
zu Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl,
sagen die Bindungsforscher. Beachtung und Anerkennung
dokumentieren die Verwandlung einer schützenden
und wertschätzenden Beziehung in eine Modalität
kohärenten Selbsterlebens.
Gesunder und pathologischer Narzissmus.
Narzissmus wird im alltäglichen Sprachgebrauch,
aber auch in der klinischen Verwendung, als Synonym
für Ich- und Selbstbezogenheit benutzt: der
Andere existiert nicht, zumindest nicht als jemand
mit eigenem Recht und eigenem Da-Sein. Der Begriff
Narzissmus besitzt hier eine pathologische Konnotation
und wird als Sammelkategorie für Objektabgewandtheit,
als objektlose Erscheinungsform des Seelenlebens
gebraucht. Umgekehrt durchzieht die psychoanalytische
Entwicklungstheorie ein nicht-pathologischer Begriff
des Narzissmus (Altmeyer, 2000). Narzissmus wird
hier in seiner gesunden Form der Selbstliebe und
Selbstachtung beschrieben. Narzissmus in diesem
Sinne ist für das Leben und Überleben
nicht nur wünschenswert, sondern von zentraler
Bedeutung. Zwischen Konzepten der Identitätsentwicklung
und dem (gesunden) Narzissmus lassen sich enge
Zusammenhänge aufweisen. Umgekehrt sind auch
Identitätsstörungen und Störungen
des Narzissmus stets miteinander verbunden. Die
Entwicklungslinie des pathogenen Narzissmus gleicht
einer Überbesetzung des Ich - in der Hypochondrie
beispielsweise einer übermässig narzisstischen
Besetzung des Körpers (Freud, 1918) - Eine
Störung des gesunden Narzissmus in in bezug
auf die Selbstliebe und die eigene Wertschätzung
bedeutet die Entwicklung von polaren Formen von
Selbstverliebtheit (statt Selbstliebe) und Selbstentwertung.
Beide polaren Formen führen die betroffenen
Menschen dazu, inständig damit beschäftigt
zu sein, ihren Wert zu beweisen zu müssen:
sie kämpfen dann gegen ein drohendes Gefühl
ihres Unwertes an und „verbrauchen“
viel Energie zur Aufrechterhaltung, Einösung
und Bestätigung eines lebensgeschichtlich
gewordenen Bildes von der eigenen Person (Busch,
1977). Die eigene Selbstverliebtheit erscheint
brüchig und
Wird allzu oft von der eigenen Selbstentwertung
„unterlaufen“. In dieser (grösstenteils
unbewussten) Dynamik hat sich längst liegt
ihr Hunger nach Anerkennung „einnisten“
können. Es ist Teil des Dramas, dass - wenn
im sozialen Umfeld Anerkennung geschenkt wird
- sie diese fast regelhaft (partiell oder gänzlich)
abschlagen bzw. relativieren „müssen“:
„Ihr neues Kleid steht Ihnen wirklich ausgezeichnet
!“ (Fast erschrockenes Innehalten) „Ja,
ich hab ganz billig neulich bei ... erstanden.“
Ein Gefühl des eigenen Wertes,
ein Gefühl der Einzigartigkeit und der Stolz
auf die eigenen Fähigkeiten, ein Gefühl
des Anerkannt-Seins und des Beachtet-Werdens durch
andere, die Befriedigung etwas sehr gut bzw. besser
machen zu können als andere in der Balance
mit Bescheidenheit, Achtung gegenüber und
Beachtung bzw. Anerkennung für andere, kann
der erwachsenen Spur des eigenen, gesunden Narzissmus
folgen und muss nicht zwangsläufig auf der
Überholspur landen... Diese Gefühle
können aber auch Angst machen. Und: sie können
einem komplexen „Abwehrprogramm“ unterliegen.
Würden wir sie zulassen, dann könnte
es sein, dass sich Spuren früher Verletzungen
und „Wunden“ auftun könnten -
beispielsweise die Spur eines lebensgeschichtlich
immer wieder erfahrenen Mangels an Beachtung und
Anerkennung. Insofern kann ein „Zuviel“
an Anerkennung und Beachtung paradoxerweise bedrohlich
werden.
Gegenüber dem erwachsenen,
positiven Narzissmus, der kindlich-normale Narzissmus:
das Bewundert-werden-Wollen („Schau, was
ich schon alles kann!“) und das teils ungenierte
Sich-Sonnen im Gefühl der Überlegenheit
(„Ich kann das ganz toll !“) - das
beim reifen Erwachsenen als Selbstverliebtheit
und egozentrisches Verhalten auffallen würde
und deshalb diskret verborgen bleiben muss. Und
ferner das kindliche Gefühl der eigenen Omnipotenz
(„Lass mich, ich kann alleine - ich kann
es besser als wenn Du mir hilfst !“) Der
kindlich-normale Narzissmus sollte sich unter
positiven Entwicklungsbedingungen und einer angemessenen
Form empathischer Konfrontation (Frustration)
in Richtung eines reifen Narzissmus (Selbstachtung,
Selbstwertschätzung und Selbstliebe) über
die Jahre wandeln können. Wenn der kindlich-normale
Narzissmus von einem steten Mangel an Beachtung
und Anerkennung unterspült bleibt oder wenn
sich die kindlichen Grössenphantasien ein
Introjekt eines omnipotenten Grössenselbst
bilden, muss die Reifung des gesunden erwachsenen
Narzissmus (als Selbstachtung und Selbstliebe)
partiell oder mehr oder minder gravierend verstellt
bleiben.
Ein Kind mit gesundem Narzissmus
lernt sein Selbst zu lieben , wenn es das Gefühl
hat, von der Familie geliebt zu werden. Ein Erwachsener
liebt und achtet sich selbst, nicht nur, wenn
er von anderen beachtet und anerkannt wird. Er
hat gelernt, auch gegen den Strom zu schwimmen.
Mit wachsender Unabhängigkeit achtet er sich
selbst auch dann, wenn er durch andere zurückgewiesen
und kritisiert wird. Ein unbewusstes Grundgefühl
des Mangels an Beachtung und Anerkennung kann
dazu führen, dass die Entwicklung des reifen
Narzissmus kindlich „steckengeblieben“
ist. Das kollektive Mit-dem-Strom-schwimmen ist
uns Deutschen aus der Geschichte sehr wohl bekannt
- gewiss spielt auch hier (aus einer historischen
und sozialpsychologischen Sicht) der Zusammenhang
der Gewährung von Anerkennung und Beachtung
(im Kontext erfahrener Kränkungen) eine zentrale
Rolle.
Ob in der gekränkten Abwendung
von der Welt, ob in der Wut auf den anderen, der
die Beachtung und Anerkennung verweigert, ob im
Rausch des offen gefeierten Erfolges, ob in der
insgeheim auf Beachtung und Anerkennung spekulierenden
Selbstinszenierung, ob in der omnipotenten Verfügung
über den Anderen oder in der symbiotischen
Unterwerfung unter ihn, ob im kreativen Prozess
der künstlerischen Produktion, ob im gesunden
Narzissmus oder in der narzisstischen Störung
- die Dynamik von Anerkennung und Beachtung zeichnet
vielschichtig-schillernde Bilder und Facetten.
In den Ausdrucksformen dessen,
was wir Narzissmus nennen, sind unbewusste Botschaften
an die Welt und die anderen Menschen enthalten.
„Schau mich an, höre mich, verstehe
mich, beachte mich, bewundere mich“ ! Oder:
„Halte mich, liebe mich, erkenne mich an!“
Die Verweigerung des Grundbedürfnisses
nach Beachtung und Anerkennung kann einhergehen
mit schweren Kränkungen und Selbst- bzw.
Selbstwertkonflikten. Sie kann zu posttraumatischen
Erlebens- und Verarbeitungsformen führen.
Ohne dass der Begriff Beachtung hier in wörtlicher
Form eine Rolle spielt - befinden wir uns hier
mitten in der Debatte um die frühen Störungsbilder
des Narzissmus und der Borderline-Thematik sowie
in den unterschiedlichen Selbstkonzepten von Kernberg,
Kohut, Mahler, Winnicott und anderr. Auch hier
in diesen Konzepten wird der Bedeutung des intersubjektiven
Prozesses der Beachtung wesentliche Bedeutung
beigemessen - wenn auch das Wort selbst „vermieden“
wird. Möglicherweise lässt sich aus
der analytischen Sicht Beachtung schwerlich definieren
und möglicherweise erscheint dieser Begriff
allzu „banal“ oder „unseriös“
für wissenschaftliches und psychotherapeutisches
„forschen“ - ähnlich wie auch
der Begriff Liebe lässt sich Beachtung nur
bedingt „exakt“ definieren - obwohl
jeder (zumindest intuitiv) weiss, worum es geht
und obwohl beide „Faktoren“ (die Liebe
und die Beachtung) so bedeutsame „Auswirkungen“
implizieren.
Der Umgang mit Beachtung und Anerkennung
ist keineswegs ein nur individuelles bzw. nur
intersubjektives Phänomen. Allgemein beobachtet,
erscheint Beachtung und wirkliche Anerkennung
im gesellschaftlich-alltäglichen Leben eher
als Leerstelle. Oberflächliche Scheinkomplimente
und weit überhöhte Anerkennungsbekundungen
(„super, affengeil, hervorragend, einfach
Klasse, ganz toll uvam...“) halten sich
die Balance mit einer entfalteten „Kultur“
offener (latenter) Entwertung und Missachtung.
Wirkliche Beachtung und Anerkennung geraten demgegenüber
eher in die Defensive und schnell in den Verdacht
idealisierender Schnulzigkeit oder vorgetäuschter
Lobhudelei. Man schämt sich fast - selbst
in vertrauten Kreisen - jemand wirklich anzuerkennen
und Beachtung zu schenken.
Über den Austausch von Anerkennung
und Beachtung regulieren wir unser Selbst- und
Selbstwertgefühl - im Guten wie im „Schlechten“.
Haben Sie sich schon einmal Gedanken über
den Wert des alltäglich und dauerhaft stattfindenden
Klatsch gemacht ? Menschen sitzen zusammen, sprechen
über andere, die nicht anwesend sind. Die
Wangen glühen, die „Einschätzungen“
werden immer treffsicherer. Man könnte sich
fast überschlagen vor lauter analytischem
„Scharfsinn“. Und. man fühlt
„Einigkeit“ mit sonst Fremden und
eine spezifische Form gegenseitiger „Anerkennung“
mittels geteilter Übereinkunft (über
all dasjenige und diejenigen, die nicht anwesend
sind). Man amüsiert sich köstlich und
findet stets einen „neuen Aspekt“.
Man bestätigt sich in der gemeinsamen Abwertung
des Anderen. Welch eine „Lust“ !
Klatsch dient dem Austausch gegenseitiger
Anerkennung und Bestätigung. Ähnlich
wie die sozialen und gesellschaftlichen Vorurteilsbildungen
im weiteren Sinn dient Klatsch der Regulierung
des eigenen Selbstwertgefühls bzw. des Selbstwertgefühls
der sozial Beteiligten. (Hiervon können ganze
Industriezweige existieren und sonst eher „leblose“
Beziehungen aufrechterhalten werden: anstelle
des zwischenmenschlichen Austauschs von Anerkennung
und Beachtung „gelingt“ - sozialpathologisch
- die eigene Selbstwertregulation durch einen
selbstbestätigenden, entwertenden „Austausch“
mit dem Gegenüber .
Wir alle brauchen Anerkennung und Beachtung. Als
Kinder und als Erwachsene. Beides „regelt“
unseren Selbstwert genauso wie unsere Identität.
Ein Kind hat seine narzisstische Selbstwertregulierung
noch nicht internalisiert. Ein Erwachsener sollte
über sie verfügen. Beachtung und Anerkennung
sind bedeutungsvoll und sind zugleich „Stolpersteine“
- unser Leben lang. Manche Menschen, die als Kinder
so viel erdulden mussten,
brechen später nicht zusammen. Die frühen
Faktoren sind nicht unbedingt die wichtigsten
- manchmal können weit spätere Faktoren
subtil wirken und entscheidende Determinanten
in der Persönlichkeitsentwicklung sein, betont
der Selbstpsychologe und Psychoanalytiker H.Kohut.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass auf der
Basis eines sicheren Selbstwertgefühls der
Austausch von Anerkennung und Beachtung keine
Rolle bzw. sich gegen „null“ bewegen
würde. Ein sicheres Selbstgefühl mag
ein kohärentes basic feeling sein - aber
es stets einem Prozess steter „Neuformulierung“
unterworfen. Solange der Selbstwert nicht nur
ein „gefühltes Inneres“ ist,
sondern stets an ein äusseres Wertesystem
gebunden bleibt, ist er stets aufs neue gefordert.
Ein die Pubertät oder ein Adoleszenz durchlaufender
Jugendlicher muss sich in der Phase der geschlechtlichen
Neuorientierung bzw in der Phase des Übergangs
ins Erwachsenenleben neuen Herausforderungen stellen
- das bestehende Selbstwertgefühl wird in
Frage gestellt, weil neue Kompetenzen der Abgrenzung
und der Anpassung an die jeweilig neue Lebensphase
noch nicht präsent sein können. Gleiches
gilt später beim Studienabschluss, beim sich
„auf jemand wirklicher einlassen“,
bei Trennungen, beim Kinderkriegen und „Aufziehen“
sowie bei der Auseinandersetzung mit Krankheit,
neuen Lebensphasen und Tod: unter normalen Umständen
brauchen wir bei alledem Anerkennung und Beachtung.
Die Kränkbarkeit einer Person verweist auf
den sensiblen Teil ihrer Lebendigkeit.
Möglicherweise trägt
der gesellschaftliche Umgang mit Beachtung und
Anerkennung spezifisch-deutsche Züge einer
Entweder-Oder-Spaltung: Erst ist jemand „super“,
dann bröckelt der Putz und letztendlich bleibt
ihm nur Schmach und Demütigung. Oder umgekehrt:
erst jemand der „loser“, steigt auf
und wird Held. dann. Ein Volk braucht dauerhaft
seine „Sieger“ und seine „Erniedrigten“
- häufig in einer Person...
MISSACHTUNG UND ENTWERTUNG.
Beachtung hinterlässt ein
Gefühl des eigenen Wertes und ein Gefühl
für die eigene Würde. Beides paart sich
mit einer Zuversicht, etwas „Gutes“
im Leben bewirkt zu haben und bewirken zu können.
Beides ermöglicht uns (eventuell) die „negative
Schleifspur“ unseres Tuns und Handelns in
Grenzen halten zu können. Das Gegenteil von
Beachtung ist Missachtung. Gewalterfahrungen sowie
körperliche, sexuelle und emotionale Ausbeutung
enthalten im Kern Missachtung. Missachtung muss
in jeder Phase des Lebens als persönliches
Defizit verarbeitet werden. Missachtung schwächt,
zerstört und verletzt Körper und Seele.
Missachtung ist Seelenmord. Sie zerstört
Formen der Selbstachtung und Selbstliebe. Auch
in einer gemässigteren Form zielt sie beim
Gegenüber nicht auf Veränderung oder
Reifung, sondern auf Rückzug, Kampf und Selbstdestruktion
- „Du wusstest noch nie, was Liebe ist !“
„Ich habe mich sehr getäuscht in Dir
!“ „Früher konnte ich wenigstens
stolz auf Dich sein !“
Die vielfältigen Ausdrucks-
und Verarbeitungsformen der Entwertung und Missachtung
bzw. des Mangels an Beachtung und Anerkennung
enthalten (zumeist unbewusste) Botschaften an
die Welt. Übersetzt lauten die positiven
suggestiven Mitteilungen des Bedürfnisses
nach Beachtung etwa so: „Schau mich an,
höre mir zu, beachte mich, schenk mir Anerkennung!“
Oder: „halte mich, erkenne mich an, liebe
mich!“ Die negativen Botschaften können
heissen: „Weil Du mir den Blick verweigerst,
weil Du mir keine Beachtung schenkst, weil Du
mir keine Aufmerksamkeit und keine Anerkennung
schenkst, ziehe ich mich von Dir zurück,
greife Dich an, entwerte oder bekämpfe Dich!“
Oder „Mit einer Welt, die mich so behandelt
hat, will ich nichts zu tun haben!“
Im zwischenmenschlich-alltäglichen oder im
therapeutischen Geschehen sind wir häufig
Adressaten solcher Botschaften. Diese unterschiedlichen
Botschaften haben eines gemein: sie zeigen ein
Verhältnis der Person zu sich selbst, das
mit dem Verhältnis dieser Person zur Welt
in einer besonderen Weise verkoppelt ist. Insofern
ist das Verhältnis dieser Person zu sich
selbst subjektiv, interpersonell und weltbezogen.
Der Andere (und die Welt) ist Spiegel des eigenen
Selbst. Und: in der Erwartung eines Echos ist
es der stumme Blick des Selbst auf den Anderen
(bzw. auf die Welt) mit der unausgesprochenen
Frage: Wer bin ich? Wie seht Ihr mich? Werde ich
gesehen? Wie siehst Du mich? Werde ich geschätzt
und geliebt oder zurückgewiesen und verlassen?
Der Austausch von Beachtung impliziert
eine durch den anderen vermittelte Selbstsicht
und vermittelt umgekehrt meinem Gegenüber
dessen Sicht von sich selbst (oder Aspekte davon).
Beachtung enthält damit stets einen selbstreflexiven
Bezug zum Anderen und zur Welt. Dies allein reicht
aber noch nicht. Wir würden uns sonst lediglich
im Spiegel unseres Gegenübers erkennen bzw.
erleben.
Die Spiegel-Metapher enthält
lediglich den Blick von aussen auf das Selbst
- nicht aber die eigene Selbstreflexivität
der Person. Letztere bedarf der Distanz und ermöglicht
erst dadurch das eigene Erleben und Wahrnehmen
des eigenen Selbst in der Vielfalt seines Seins.
Erst in diesem dialektischen Prozess zwischen
Selbst und Gegenüber bzw. zwischen Selbst
und Welt, entwickelt sich der Zusammenhang und
die Balance von Beachtung und Selbstachtung, von
Selbsterkenntnis und Selbstgewissheit.
Zu den traumatischen Erfahrungen des Mangels bzw.
des Entzugs von Beachtung gehören gleichermassen
Erfahrungen des Zurück-gewiesen-Seins und
des Nicht-dabei-sein-Dürfens. Beispiel: „Du
tätest besser, wenn Du nicht auf der Welt
wärest“ - „Mir wäre lieber
gewesen, wenn Du ein Junge (oder ein Mädchen)
geworden wärest“. Oder im Sinne der
„abgeschwächteren“ Formen latenter
Entwertung von „So, wie Du bist, kann ich
Dich nicht wirklich lieben“. Oder: „So
manches ist schon recht an Dir, aber eigentlich
bist Du nicht richtig für mich)“ oder
„Wärest Du so oder so, dann könnte
ich Dir auch meine eigentlichere Zuwendung und
Beachtung schenken. Aber Du bist halt nur so...“
In der Erzählung des
Ovid der existentielle Konflikt zwischen dem Bedürfnis
nach und der Verweigerung nach Beachtung eindrücklich
dargestellt: die Nymphe Echo liebt den jungen
Jäger Narziss leidenschaftlich Aber Narziss
aber ist nicht in der Lage, diese Liebe Echos
zu erwidern. Narziss verweigert Echo seine Beachtung.
Und im Leid verschmähter und unbeantworteter
Liebe sowie im Mangel an würdigender Beachtung
bleibt Echo nur der quälende Weg der eigenen
Verwandlung zu Stein. “Niemand vermochte
den Schönen (Narziss) zu rühren“,
schreibt Ovid. Als Stein geworden, kann die Nymphe
Echo lediglich Worte widerhallen - durch den Mangel
an Beachtung verliert sie ihre eigene Sprache.
Der Ausdruck ihrer Leidenschaft und Liebeskraft
bleibt versteinert und verunmöglicht. Narziss
indessen findet ein Gewässer und entdeckt
spiegelbildlich seine eigene Schönheit.
SELBSTLIEBE VERSUS SELBSTVERLIEBTHEIT.
Aber dieses Spiegelbild, dass
Narziss an der Wasseroberfläche entdeckt,
ist kein inneres Bild seines eigentlicheren Selbst,
sondern gibt ein Bild wider, das die Aussenwelt
(hier in der Form der spiegelnden Wasseroberfläche)
von ihm hat. In dieses Bild verliebt sich der
Jünglich Narziss. Dieser Spiegel ist subjektlos.
Narziss liebt nicht sich selbst im eigentlicheren
wie im gesund-narzisstischem Sinn. Narziss entdeckt
seine Schönheit in eigener Selbstverliebtheit.
(Narzissmus bezeichnet demgegenüber im ursprünglichen
Sinn die gesunde Selbstliebe, die für das
leibseelische Wohlbefinden notwenig ist. Gesunder
Narzissmus heisst ursprünglich die Balance
zwischen Selbstachtung, die aus der lebensspezifischen
Bewältigung von Anforderungen erwächst
und dem Vertrauen auf die Hilfe und Unterstützung
durch andere, wichtige Menschen. Um im Leben zurechtzukommen,
muss sich ein Mensch selbst lieben und achten).
Narziss` Selbstverliebtheit ruft
den Groll der Götter hervor – sie können`s
einfach nicht mit ansehen ! Narziss darf als Mensch
nicht weiterleben - die Götter verwandeln
sein menschliches Wesen in eine Pflanzengestalt.
Mögen Menschen ihn in der Form einer Blumengestalt
bewundern - vom zwischenmenschlichen Prozess des
Austauschs von Beachtung und Anerkennung bleibt
er ausgegrenzt.
Menschen, die ihre Grundbedürfnisse
mangelhaft (möglicherweise gar nicht) sättigen,
austauschen und befriedigen, werden krank. Psychisch,
somatisch, psychosomatisch. Dies gilt für
die primären Bedürfnisse ebenso wie
für die sekundären d.h. die sozialen
Bedürfnisse. Perls (1976) sprach von Löchern
in der Persönlichkeit und bezog sich auf
den Mängel des Austauschs von Beachtung.
Bietet ein Therapeut, der bei sich in Bezug auf
den Klienten eine positive Wertschätzung
erlebt, diesem emotionale Wärme an und begegnet
ihm darin, dann wird er auch beim Klienten ähnliche
Gefühle hinsichtlich dessen Selbst auslösen,
so dass dieser sich selbst ebenfalls mehr Achtung
und Akzeptanz entgegenbringen kann, betonte Rogers
(1987). In der Selbstpsychologie Kohuts (1993)
wird zum einen die Bedeutung des Austauschs von
Empathie und Gegenseitigkeit hervorgehoben und
zum anderen die Sucht nach einem bewundernden
Anderen zur Regulierung des Selbstwertgefühls
hervorgehoben.
Aus existenzphilosophischer Sicht
– wie aus psychodynamischer und entwicklungspsychologischer
Sicht - dient die Beachtung bzw. der Austausch
von Beachtung der Bestätigung des Da-Seins.
Wenn wir dem Anderen Beachtung schenken, sagen
wir ihm damit zwangsläufig: “Ich sehe
Dich.” Dadurch bestätigen wir sein
Dasein - auf die eine oder andere Weise. In und
mittels unserer Beachtung vermitteln wir dem Anderen
ein Gefühl von "Du bist da.” (vgl.
hierzu die Schriften von Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty,
Buber, Rogers, Perls u.a.)
Jeder von uns kennt den Unterschied
zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Jeder
von uns ist in der Zeit auf die eine oder andere
Weise nicht beachtet worden, als die, die wir
waren und die, die wir sind - als quengelnde Babies,
als spielende Kinder, als Jungen oder Mädchen,
als ihre Sexualität aufspürende Jugendliche,
als Männer und Frauen, als Liebende oder
als Menschen in Krisen und Krankheit. Der Mangel
an Beachtung konnte weh getan haben, und er konnte
in der Zeit auf die eine oder andere Weise verarbeitet
und aufgehoben werden - durch neue Erfahrungen,
liebevolle Beziehungen und einem Sich-Stellen-in-der-Welt.
VOM HEILEN UND VON DER WIEDERKEHR VON
WUNDEN.
Unser Gesamtorganismus als Körper-Seele-Selbst-Geist
Ganzheit verfügt über zwei existentielle
„Linien“ der Entwicklung - beide Linien
werden seit Jahren übrigens auch von der
modernen Gehirnforschung aufs Neue belegt:
Erstens. Die Erfahrung des Mangels
an Beachtung, einschliesslich der Erfahrung von
Demütigung und Entwertung können sich
aufhebend lösen und integriert werden. Diese
Möglichkeit entspringt dem gesamtorganismischen
Potential Geschehenes abzuschliessen und heilen
zu lassen, damit die blockierte Entwicklung der
Person fortschreiten kann. Die moderne Gehirnforschung
spricht in diesem Zusammenhang vom Wirkmechanismus
der informationsverarbeitenden Systeme, die nach
dem Prinzip des Ausgleichs, der Verarbeitung von
Erlebtem sowie einer Spur der Homöostase
und des Ausgleichs folgen. Erfahrungen werden
(teilweise partiell) wiedererlebt, verarbeitet
und integriert - diesem Aspekt war aus der Sicht
der Psychoanalyse bereits Freud in seinen Beschreibungen
der Bedeutung des Traumes gefolgt. Weitere Arbeiten
aus der Humanistischen Psychotherapie, letztendlich
auch aus der Medizin sind bekannt.
Zweitens: Die Verarbeitung von
Erfahrungen des Mangels an Beachtung, einschliesslich
von Erfahrungen von Demütigung und Entwertung
kann deshalb blockiert sein, weil unser Gesamtorganismus
über eine Linie des Sich-Schützens verfügt.
Gemeint ist der Schutz vor erneutem Schmerz und
erneuten Verletzungen, welche Gefahren signalisieren
und gewachsene Ressourcen bedrohen können.
Diese Linie könnte man Vermeidung nennen:
die Vermeidung dient dem Schutz. Psychische wie
körperliche Abwehrmechanismen machen Sinn,
weil sie Schutz gewähren, selbst dort, wo
kein Schutz mehr nötig ist. Der vermeidende
teil des Selbst ist bestrebt die Person zu schützen
- zu schützen vor dem erneuten Wieder-Erleben-Müssen.
Emotionale Betäubung, Gefühle
der Grossartigkeit, Mechanismen der Spaltung und
Dissoziation, gekränkte Abwendung von der
Welt, destruktive Rache, stille Anklage, die Aufrechterhaltung
des Opfer-Seins - all dies kann uns schützen
- zumindest im inneren Bild und in der eigenen
(bisweilen unbewussten) lebenspraktischen Auseindersetzung
mit anderen Menschen und mit der „Welt“.
Ob uns dieser Schutz „wirklich“ schützt
- ist eine andere Frage.
BEACHTUNG UND ANERKENNUNG
- ÜBERGÄNGE UND UNTERSCHIEDE.
Beachtung meint Aufmerksamkeit
gegenüber der Existenz des Anderen. Sie meint
Aufmerksamkeit fbezogen auf das DaSein unseres
Gegenüber. Anerkennung bekommen wir aus lebensgeschichtlichspäter
Perspektive gesehen später. Wir bekommen
sie dann für das, was wir leisten, was wir
lernen und gelernt haben; für das, was wir
tun und wir bekommen sie dafür, wie wir etwas
tun. Anerkennung differenziert in gut, in weniger
gut, in schlecht oder mittelprächtig - Beachtung
differenziert nicht. Sie gilt vielmehr dem Eigentlicheren
in der Person, also dem der wir eigentlicher sind.
In der Literatur finden wir hier Begriff des Wahren
Selbst, des Kerns oder des Wesens einer Person.
Jemandem Beachtung schenken meint, dass wir einen
inneren Zustand einnehmen, bei dem wir unser "Ego"
ein stückweit hinter uns lassen und damit
frei (freier) von Wertungen, inneren Überzeugungen,
Wünschen und Projektionen werden können.
Diesen Zustand können wir bewusst einnehmen
im einfachen Schauen, Spüren und Staunen.
Es ist wichtig, zwischen Anerkennung
und Beachtung zu unterscheiden - meines Erachtens
ist es wichtig, sich diesen Unterschied zu vergegenwärtigen.
Eine Verwechselung und ein "Durcheinanderbringen"
von Anerkennung und Beachtung bzw. ein Nicht-unterscheiden
zwischen dem Bedürfnis nach Anerkennung und
dem Bedürfnis nach Beachtung kann negative
Auswirkungen zeitigen.
Ein Beispiel.
Viele Studierende erhoffen sich (zumeist unbewusst)
während der unmittelbaren Situation ihrer
Examensprüfung auch Beachtung von der Person
des Prüfers/der Prüferin. Sie hegen
dann den (zumeist unbewussten) Wunsch als "ganze
Person" wahrgenommen zu werden und „vergessen",
dass es in diesen Examensprüfungen im Grunde
nur um Anerkennung für die Möglichkeit
des Abrufens von Wissen gehen kann. Mag ihr Wunsch
nachvollziehbar sein - Prüfungen sind aber
"nur" Prüfungen, und neben einem
Austausch von Freundlichkeiten kann es lediglich
um den Austausch von Anerkennung gehen: Anerkennung
für die Wiedergabe des Erlernten, der wissenschaftlichen
Präsentation uam. Um Beachtung im oben genannten
Sinne kann es nicht gehen. Wenn eine Prüfung
derart „aufgeladen“ wird, dann kann
es sein, dass der Prüfer/die Prüferin
sich in der unmittelbaren Situation des Prüfungsgeschehens
in der Gegenübertragung (eher unbewusst)
dagegen wehrt (weil er/sie sich quasi überfordert
fühlt) Dies kann dazu führen, dass ein
angemessens Mass eigener Anerkennung durch den
Prüfer „zurückgenommen wird -
bis hin zur vollständigen Nichtgewährung
von Anerkennung.
Auf der Seite der Studierenden
kann das unbewusste Zusammentreffen des Wunsches
nach Beachtung und des Wunsches nach Anerkennung
zu „unguten“ Gefühlen - auch
zu für Prüfungsängsten führen.
Wenn sich in alltäglichen
Beziehungen bzw. in Liebesbeziehungen die Frage
„Liebst Du mich und siehst Du mich auch
wirklich ?“ chronifiziert und ständig
„mitgeschleift“ wird, sind Beziehungsverstrickungen
unausweichlich. Und: der Mangel an subjektiver
Unterscheidungskompetenz kann dazu führen,
dass selbst einfachste Anerkennung ausbleibt und
aggressiv konontiert verwehrt bleibt - der Kreislauf
des Mangels an Beachtung und der Kreislauf der
Selbstentwertung bzw der Entwertung durch andere
kann erneut in Gang gesetzt werden...
Beachtung stärkt unser Grundgefühl
von " Ich bin ", von "Ich bin in
der Welt,', von " Ich bin Teil dieser, meiner
Welt ", von „der andere sieht mich,
ich fühle mich gesehen“, „ich
fühle mich grundsätzlich angenommen“.
Ein Gefühl des "In der
Welt seins" ist ein existentielles Merkmal
des Menschen - dies betonten sehr eindrücklich
die Vertreter der Existenzphilosophie und Phänomenologie
sowie auch bedeutsame Vertreter der Humanistischen
Psychologie und Psychotherapie, welche sich unabhängig
und neben dem Klinischen und Pathogenem „im“
Menschen dessen Wachtums- und Existenzfragen widmeten.
(W. Reich, C.G. Jung, F. Perls, C. Rogers uam.)
In der körperorientierten Psychotherapie
gibt es vielfältige Möglichkeiten mit
Hilfe von Übungen und Behandlungstechniken
an diesen existentiellen Momenten zu arbeiten.
Im wissenschaftlichen Diskurses der sogenannten
Richtlinien-Psychotherapieverfahren der Klinischen
Psychologie und Psychotherapie werden solche Fragestellungen
immer weniger thematisiert.
Wir brauchen beides: Anerkennung und Beachtung.
Beides dient dem Wachstum der Person. Und so wichtig
es ist, zwischen beidem zu unterscheiden, so schwerlich
ist es häufig, zwischen beidem unterscheiden
zu können -häufig fügt sich das
Eine im Anderen.
Ein Beispiel.
Meine Tochter Sophie (10 Jahre) malt ein buntes
Bild und zeigt es mir voll Stolz. Ich kann ihr
Beachtung schenken im Sinne des "es ist ein
Bild von Dir" und ich kam gleichzeitig Anerkennung
zollen im Sinne von "wie schön hast
Du die Farben ausgewählt, wie phantasiereich
ist das Bild im Gesamten“. Mich auf der
Ebene der Anerkennung bewegend, zolle ich ihr
Lob (Anerkennung) und verbleibe vorwiegend in
der Rolle des begutachtenden Vaters. In dieser
Rolle „verbaue“ ich mir die Möglichkeit
der Beachtung. Diese Stimme würde vermitteln:
„Es ist ein Bild von Dir.“ Diese Stimme
würde den Glanz in den Augen bemerken und
die Hinbewegung hin zu mir spüren. Sie würde
registrieren, dass es ein Geschenk ist - ein Geschenk
von ihr für mich. Vielleicht aus Dankbarkeit
– vielleicht aus einer momentanen Stimmung...
Dann verlasse ich de Ebene der
Anerkennung (hier durch Lob) und öffne uns
eine (eh schon offene) Pforte: den Austauschs
von Beachtung.
Wir brauchen beides: Anerkennung
und Beachtung. Wir können beides austauschen,
auch „fliessend“ - aber wir sollten
den Unterschied nicht „vergessen“.
Und darauf achten: wann, wo, mit wem, auf welcher
„Grundlage“ , wie viel? ... (nicht
auf technischer, sondern selbstreflektorisch-intuitiver
„Grundlage“)
Wenn wir über die Zeit der
vielen Jahre "verlernt" haben, den Unterschied
zwischen unserem Bedürfnis nach Beachtung
und unserem Bedürfnis nach Anerkennung wahrzunehmen
und der Neigung verfallen, beides beständig
miteinander zu "verwechseln"; wenn wir
ferner in einem (eher unbewussten) Mangel an Beachtung
(im Sinne des Gesehen-werden-wollens) verharren,
dann kann es dahin kommen, dass wir in der Zeit
abhängig werden von äusseren Quellen
der Anerkennung, um damit die "Löcher"
die durch den Mangel an Beachtung (bzw. durch
Entwertung und Demütigung) entstanden sind,
kompensatorisch „zustopfen“ zu wollen.
Dann kann es sein, dass wir nach aussen gerichtet
ganz viel tun und leisten, um Anerkennung zu erheischen
- im eher vor- oder unbewussten Wunsch (Grundbedürfnis
nach Beachtung. Und: es kam sein, dass wir - trotz
aller Anerkennung - quasi leerlaufen - im ungestillten
Bedürfnis und dem Hunger nach Beachtung.
DER HUNGER NACH ANERKENNUNG.
Ein Mangel an Beachtung für
das Eigentlichere in uns kann uns dazu führen,
ganz viel tun zu "müssen", um sie
doch noch - oder an ihrer stelle „wenigstens“
- die Anerkennung zu bekommen. Die kompensatorischen
Möglichkeiten des Umgangs mit dem Selbst-
und Selbstwertkonflikt sind vielfältig. Er
reicht von „blinder“ Kontrolle anderen
Menschen gegenüber zum Selbstlauf des Anhäufens
von Macht und Ansehen (im kleinen wie im Grossen);
vom „Sammeln“ von Beziehungen und
dem heimlichen Zwang „In-und-cool-sein-zu-müssen“.
Wir kleiden uns schick, zeigen die Familie her
und verkörpern angepasste Effizienz (oder
auch eine chronische Form postpubertärer
Nichtangepasstheit). Vielleicht suchen wir spirituelle
Lehrer, die gerade "in" sind und einen
hohen Tauschwert garantieren. In der Postmoderne
ist selbst Sinnfindung und geistige Entwicklung
interpersonell vermarktbar. Aber bei alledem bleiben
wir wie einst das brave Kind: wir entwickeln feinfühlige
Sensoren dafür, was Anerkennung „bringen“
kann und wofür wir Beachtung (letztendlich
Liebe) und Seelenfrieden bekommen können.
Als Kinder fingen wir an, "lieb und brav"
zu sein, "gut und schlau", "sauber
und freundlich" und entwickelten bei alledem
feinfühlige Sensoren dafür, uns anerkannt
und "geliebt" zu fühlen zu können.
Dies alles um der ungeheuren Macht des Schmerzes
gegenüber dem Gefühl des Ungeliebt-seins,
des Nicht-gewollt-seins
Und des Ausgeschlossen-seins aus dem Wege zu gehen.
Erst in Therapien wird oftmals offenkundig, wie
viel
Menschen dafür investieren (und investiert
haben) g e l i e b t z u w e r d e n.
Im Zeitalter der sog. Postmoderne
hat sich der Austausch von Formen oberflächenhafter
Anerkennung verbreitert, überhöht und
"verschnellert". Wir erhalten oft sehr
schnell Anerkennung - viel schneller als früher
("find ich Spitze..." "find ich
ganz toll...."). Es scheint, als ob sich
die Schere zugunsten oberflächlicher Anerkennung
und zuungunsten der des Austauschs von Beachtung
verschiebt.
Im lebensgeschichtlichen Ringen
um Anerkennung kann es sein, dass wir verlernen,
zu fühlen und zu "wissen" was Beachtung
ist. Und es kann passieren, dass - wenn wir Beachtung
bekommen - ganz irritiert sind. Es kann sein,
dass uns Beachtung eher verstört sind und
wir glauben, es müsste sich um ein Irrtum
handeln. Es kann vorkommen, dass wir Beachtung
als bedrohlich erleben oder dass wir glauben,
sie könnte unmöglich uns gehören.
(letzteres finden wir im Alltag und häufig
in Psychotherapien). Und es kann drittens sein,
dass wir in all dem Ringen um Anerkennung, diese
dann gar nicht annehmen können, wenn sie
uns geschenkt wird...
Während meiner mehrjährigen
therapeutischen Arbeit mit an HIV und an AIDS
erkrankten Menschen habe ich häufig die folgende
Erfahrung machen können: diese Menschen bekamen
von nahen Freunden und Angehörigen trotz
ihrer Krankheit, ihrer Bettlägerigkeit und
ihrer betreuerischen Abhängigkeiten Beachtung.
Diese Beachtung galt den erkrankten Menschen und
ihrem "Schicksal", mit dem sie eindrücklich
konfrontiert waren. Diese Menschen waren oft ganz
hin und her zwischen Dankbarkeit, Rührung,
Verwirrtheit und Ablehnung. Manchen war diese
Beachtung viel zu viel - insbesondere zu einem
Zeitpunkt, zu dem sie sich trennen mussten von
sozial anerkannten Attributen und "Werten"
der Leistungsfähigkeit, der Attraktivität,
des Gesundseins und der Selbständigkeit.
Es schien so, als ob die Freunde und Angehörigen
- mehr und anders als ehedem - ihretwegen und
zu ihnen kamen. Und umgekehrt, die Betroffenen
machten sich auf den Weg, das Annehmen von Beachtung
neu erlernen zu müssen.
Alles, was wir Menschen miteinander und untereinander
tun, basiert „untergründig“ auch
dem Austausch von Anerkennung - möglicherwiese
auch dem Austausch von Beachtung. Der oft untergründige
Austausch von Anerkennung ist in der Regel eher
vor- oder unbewusst. Er „schwingt“
mit ohne angesprochen zuwerden.
Beispiel: hier und gerade. Offiziell ein Fortbildungsworkshop;
untergründig auch Austausch von Anerkennung
Ich selbst bekomme Anerkennung (hoffentlich !).
Und ich selbst schenke Anerkennung (hoffentlich
!) - der gesamten Gruppe und jedem Einzelnen.
Am Ende der Fortbildungstage geht es uns in der
Regel gut, manchmal sehr gut (manchmal auch weniger
gut oder gar schlecht). Und am Ende der Tage nehmen
wir - jeder von uns - das Gefühl mit, "wahrgenommen,
gesehen worden zu sein bzw. andere wahrgenommen
und gesehen zu haben". In der einen oder
anderen Art und Weise.Das deutet darauf hin, dass
sich die Einzelnen Teilenhmer und Teilnehmerinnen
der Grupppe untereinander und mit mir begegnet
sind. Jeder tut das auf seine eigene Art und Weise.
Ob wir lehren, lernen, lieben, predigen, zuhören
musizieren oder unser täglich Tagwerk tun;
beständig Austausch von Anerkennung, partiell
auch Austausch von Beachtung.
Unsere spätIndustrielles
System einschliesslich der postmodernen Gesellschaftskultur
lebt inständig vom Austausch von Anerkennung
sowie vom vor- oder unbewussten Hunger nach beidem.
Jeder von uns will "gesehen und wahrgenommen"
sein. Aus der Sicht der materiellen Welt sind
der scheinbaren Sättigung des Bedürfnisses
nach Anerkennung und „gesehen sein“
kaum Grenzen gesetzt. Ganze Industriezweige leben
davon - die Kosmetik- und Kleidungsindustrie,
die Autoindustrie, die Medienindustrie, die Designeindustrie,
die Kulturindustrie, die Ökoindustrie, die
Sportindustrie und vieles andere mehr. Jede Ware
könnte neben dem Preisschild einen „Anerkennungsaufkleber“
tragen. "Hinter dem Rücken der Dinge"
(hinter dem materiellen und ideellen Schein) geht
es mittels dieser Dinge wesentlich um den regen
Austausch von Anerkennung und - sozusagen tiefgründiger
- um die Sehnsucht und den Hunger nach Beachtung.
Kommt es dazu, dass all die Dinge den "schönen
Anerkennungs-Schein und dessen Wert darin"
verlieren, dann landen diese Dinge auf dem Müllhaufen
der Geschichte: im Hunger nach Beachtung und im
Spiel des Austauschs von Anerkennung haben sie
offensichtlich ihren Platz verloren und müssen
einen Deponieplatz einehmen... anderes wird bedeutungsvoller...Der
Hunger bleibt nur die „Dingenwelt“
wir ersetzt und erneut ausgetauscht...
Beispiel:
Denken Sie an die rosa Plüschkissen in den
Hutablagen der Rückfenster der Opels der
60iger Jahre; an die Zeit der Verspoilerungen
der 70iger und 80iger Jahre; an das Edelholzdesign
der 90iger Jahre und an die heutigen Möglichkeiten,
sich ein Auto „ganz nach dem eigenen Geschmack“
produzieren und disignen lassen zu können.
All die diente und dient in der Zeit auch dem
Austausch von Anerkennung und dem unbewussten
Wunsch nach Beachtung. Und alles verliert in der
Zeit diese Funktion, sobald sich verändernde
Zeiten diesen Dingen diese Funktion entziehen...
Für einen grossen Teil der
Bevölkerung zeigt sich Krisenzeiten der Ökonomie
und Politik der folgende Kreislauf:
wenn hier die Hoffnung den inneren Mangel an Anerkennung
durch äussere Dinge ausgleichen zu können
nicht -oder besser: weniger denn je erfüllt
wird - dann können die subketiven Kränkungsgefühle
besonders gross werden. Und wenn sich diese Kränkungsgefühle
einerseits mit enttäuschten Hoffnungen (aus
der Zeit der Wiedervereinigung) und andererseits
mit realen Ängsten verbinden, dann entwickelt
sich ein sozialpsychologisches bzw. poltisches
Klima, dass zwischen Depression/Frustration und
Resignation und Wut/Radikalisierung und destruktiver
sind Gewalt hin und her zu schwanken scheint.
Solange das Bedürfnis nach
Beachtung vor- oder unbewusst bleibt, solange
wir angewiesen auf zufällige Quellen der
Anerkennung. Solange sich unser Hunger nach Beachtung
als unstillbar erweist, solange bleiben wir in
dem, was wir tun und in dem wie wir es tun, beeinträchtigt.
Wir tun dies dann weder der Sache wegen, noch
aus unseren Sinnen und aus eigenem Engagement
heraus. Wir tun es weniger im Kontakt mit unserem
Sein und unserer Person (Büntig), sondern
wir tun es, um einen grösstmöglichen
Teil unseres vor- oder unbewussten Hungers nach
Beachtung bzw. nach Anerkennung zu befriedigen.
Hierin laufen wir Gefahr, uns zu verzehren - heute
weniger, morgen mehr....
Wenn wir "verlernt"
haben, zwischen unseren Bedürfnissen nach
Beachtung und Anerkennung zu unterscheiden, wenn
uns unser Grundbedürfnis nach Beachtung sehr
weitgehend aus dem inneren, emotionalen Sichtfeld
"rutscht" und wenn wir drittens wenig
bewusst darin sind, wann, wieviel, von wem, für
was wir Anerkennung brauchen, dann bleiben wir
angewiesen auf zufällige Quellen der Anerkennung.
Wenn wir - umgekehrt Anerkennung und Beachtung
direkt und bezogen austauschen - wenn wir immer
mal wieder schauen und sehen, wer Du bist und
wenn wir darangehen, uns dem anderen zu zeigen,
wer wir sind, wenn wir uns ferner üben im
genaueren u Hinhören, was der Andere sagt
- dann erübrigt sich das zumeist ablenkende
„Gequatsche“ über dies und jenes.
- Der Andere hat mir zugehört, der andere
hat mich wahrgenommen und gesehen. All dies in
den Grenzen dessen, was möglich ist. - das
tut gut...
Wenn wir mit unserem Grundbedürfnis
nach Beachtung unbewusst umgehen, und uns auf
den den kompensatorischen Weg des Erheischens
von Anerkennung machen, dann bleiben wir (und
werden immer aufs Neue) abhängig von zufälligen
Quellen der Anerkennung und den vielen "falschen
Formen der Beachtung ". Wir machen uns auf,
denjenigen Menschen und „Mächten“,
sehr viel Einfluss über uns zu geben, die
uns Anerkennung zollen. Je mehr emotionaler Druck,
desto zufälliger die Quellen und je intensiver
die Abhängigkeit.
Je mehr Hunger, desto mehr verlieren wir unsere
inneren "Richtschnuren" für das,
was "richtig" und wichig für uns
ist und für das, was "falsch" ist
und was uns eigentlich schadet. Der Hunger nach
Anerkennung kann zu einer Art Sucht werden. Sucht
macht bekanntlich blind. Wir verlieren uns in
Abhängigkeiten. Weil diese weitgehend immaterieller
Art ist, ist sie schwer sichtbar - anders als
die Sucht jeden Tag zur Flasche greifen zu müssen.
In Abhängigkeit von Quellen der Anerkennung
überlassen wir den Anderen Macht über
uns gewinnen. Wir verlieren den Kontakt zu all
dem, was wir "eigentlicher" wollen und
den Kontakt zu dem, was wir "eigentlicher"
sind. Wir verlieren den Kontakt zu unseren inneren
gedanklichen und sinnlich-emotionalen Informationsquellen,
die uns andeuten, worum es "eigentlicher"
geht in unserem Leben - im alltäglichen Hier
und Jetzt und im Zukünftigen. (Büntig,...)
In der vor- bzw. unbewussten Abhängigkeit
von Anerkennung und Beachtung können unsere
Gegenüber die Schraube anziehen und lockern.
Je grösser unser innerer emotionaler Hunger
und je grösser unsere Abhängigkeit von
den zufälligen Quellen, desto grösser
die Angst vor dem Verlust dieser Quellen. Wenn
wir diese äusseren Quellen als verinnerlichte
Repräsentanzen installiert haben, dann kann
sich das Mass unserer Abhängigkeit um ein
weites verdichten und vergrössem.
Der unbewusste Hunger nach Anerkennung
kam uns an andere Menschen binden - sowohl in
der Form der Dominanz als auch in der Form der
Unterwerfung. Solche Bindungen haben stets destruktiven
Charakter. Wir brauchen solche Bindungen wesentlich
zur Aufrechterhaltung und zur Regulierung unserer
Bedürfnisse nach Anerkennung bzw. nach Beachtung
bzw. zur Regulierung unseres Selbstwertes. Scheinbar
können wir unseren unseren Hunger stillen.
Aber was ist, wenn der andere „aussteigt“
? Je abhängiger wir sind, desto "schaler"
schmecken solche Bindungen - bisweilen müssen
wir uns der Anderen entledigen, weil wir die eigene,
negative Abhängigkeit und das eigene Gefühl
des Ausgeliefertseins immer deutlicher spüren
und "abstreifen" wollen, wie eine Schlangenhaut.
Liebesliedertexte bringen es auf einfache Weise
ans Tageslicht: Ohne Dich bin ich nichts...";
Nur Du, Du, Du allein..."; "Only you..."
Die modernen Texte der neuen Popkultur sind nur
marginal anders.
Wenn wir lernen, mit unserem Grundbedürfnis
nach Beachtung bzw. unseren Bedürfnissen
nach Anerkennung bewusster umzugehen, dann entfallen
die zahlreichen zufälligen Quellen, die diese
beiden Bedürfnisse scheinbar zu sättigen.
Umgekehrt: der unbewusste Umgang mit diesen Bedürfnissen
lässt uns - mal mehr, mal. weniger - nicht
wirklich satt werden. Wieder: wenn wir etwas tun
und nicht satt werden, liegt Sucht vor - wenn
ein Bedürfnis durch anderes Bedürfnis
"überdeckt" wird, wir aber gleichzeitig
ein Gefühl dafür besitzen, was wir „eigentlicher“
wollen und wollten, dann wir ungesättigt.
Der Hunger nach Anerkennung und das unbewusste
Umgehen mit Beachtung können zur Sucht werden.
Beispiel: wem sich der Hunger nach Anerkennung
und der vor- oder unbewusste Wunsch nach Beachtung
sexualisiert und erotisiert, dann schlafen Menschen
miteinander und bleiben trotzdem unbefriedigt.
Weil das ,eigentlichere" Bedürfnis nicht
"zur Sprache" kam, kann es für
den Moment "schön" gewesen sein
- können sich aber im Nachhinein wieder die
alten "Löcher" auftun. Das existentielle
Grundbedürfnis nach Beachtung lässt
sich nicht mit einem lebensgeschichtlich "späteren"
Bedürfnis - der Sexualität abdecken
und sättigen; so wie wir Durst nicht mit
Kartoffelbrei löschen können.
All dies ist ein alltäglicher
Prozess des Lernens und Übens.
• Schauen, wieviel wir tagtäglich dafür
tun, um Anerkennung zu bekommen.
• Wie abhängig und/oder
wie unabhängig wir äusserer Anerkennung
sind ?
• Wieviel Anerkennung schenken
wir uns selbst und wie viel Anerkennung schenken
wir Anderen?
• Für was, von wen,
zu welchem Zeitpunkt, in welchen Zusammenhängen
suchen wir Anerkennung ?
• Unterscheiden und erahnen
wir echte von eher „unechter“ Anerkennung
? Wie unterscheiden wir zwischen Anerkennung und
Beachtung ?
• Von wem wollen wir beachtet
werden ? Von wem wollen wir gesehen und wahrgenommen
werden?
• Wie lebt es sich, wenn
wir uns von unseren eingeschliffenen Ritualen
des Heischens nach Anerkennung und Beachtung lösen?
• Welche Quellen der Anerkennung
erscheinen uns zufällig?
• Wieviel Beachtung schenken
wir uns selbst (Selbstachtung)?
• Können wir Anerkennung
und Beachtung wirklich annehmen? Oder sind wir
dauerhaft skeptisch?
• Wie "verführbar"
sind Sie in Sachen Anerkennung?
SCHLUSSBEMERKUNG
Im Wissen um die positive Bedeutung
der Rolle von Anerkennung und Beachtung scheint
mir, dass wir uns erst in der Hinwendung und Auseinandersetzung
mit dem, was uns eigentlicher interessiert (Interesse
= Dabeisein) und dem, was unsere wirklichere Aufmerksamkeit
fordert, von der Zufälligkeit und der Ausgeliefertheit
an die vielfältigen Formen und Möglichkeiten
des Ringens um Anerkennung und Beachtung lösen
können. Wir können dann anders in unser
Tun und Sein eingehen. Wir können unsere
Beziehungen und Kontakte zu Menschen und zur Welt
bei weniger Ringen um Anerkennung mehr gestalten
und kreieren lernen.
LITERATUR
Büntig, W.: Persönlicher
Vortrag
Busch, T.: Theoretische Aspekte und therapeutische
Arbeit mit dem Selbst
Kohut, H.:Die Heilung des Selbst
Miller, A.: Grandiosität und Depression
Verfasser:
Dr. phil Thomas Busch
(7.10.1947- 30.4.2006)
Redaktion/Randbemerkungen:
Ina Citron
Ausbildungsinstitut - DG Kinästhetik
Althoffstr. 20 - 12169 Berlin
Ich danke Dr. Thomas Busch
für die freundliche Überlassung des
Fachartikels im Rahmen der beruflichen Weiterbildung
für Kinästhetik-Trainer/innen und andere
Unterrichtende körperorientierter Verfahren.
|
|